Gemarkungsgrenzen von Mühlheim
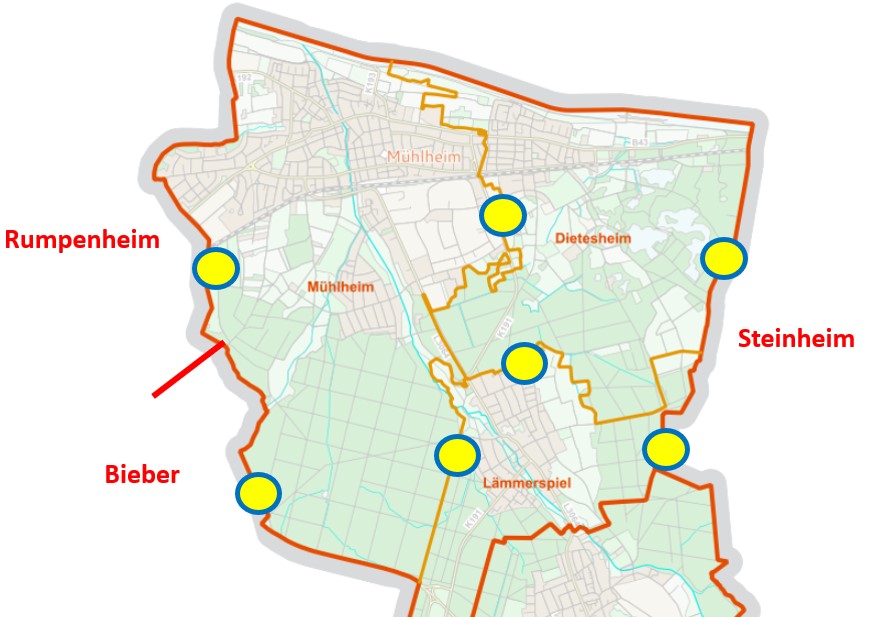
 Wir
beschäftigen uns in diesem Kapitel mit den Grenzen der Stadt
Mühlheim. Sie besteht aus den Gemarkungen Mühlheim,
Dietesheim und Lämmerspiel. Dietesheim
wurde 1939 und
Lämmerspiel 1977 nach Mühlheim eingemeindet. Diese
Gemarkungen bilden eine Ausstülpung des Kreises Offenbach nach
Norden, die durch die "Auskreisung" von Steinheim zu Hanau in den
Main-Kinzig-Kreis 1974 entstand. Die drei
Ort gehörten bis
1803 zu Kurmainz, danach zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum
Großherzogtum Hessen. 1819 wurde die Biebermark unter den
Markgemeinden aufgeteilt. Die Gemarkungsgrenzen wurden mit dieser
Aufteilung definiert. Der Markwald wurde somit zum Gemeindewald.
Wir
beschäftigen uns in diesem Kapitel mit den Grenzen der Stadt
Mühlheim. Sie besteht aus den Gemarkungen Mühlheim,
Dietesheim und Lämmerspiel. Dietesheim
wurde 1939 und
Lämmerspiel 1977 nach Mühlheim eingemeindet. Diese
Gemarkungen bilden eine Ausstülpung des Kreises Offenbach nach
Norden, die durch die "Auskreisung" von Steinheim zu Hanau in den
Main-Kinzig-Kreis 1974 entstand. Die drei
Ort gehörten bis
1803 zu Kurmainz, danach zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum
Großherzogtum Hessen. 1819 wurde die Biebermark unter den
Markgemeinden aufgeteilt. Die Gemarkungsgrenzen wurden mit dieser
Aufteilung definiert. Der Markwald wurde somit zum Gemeindewald. 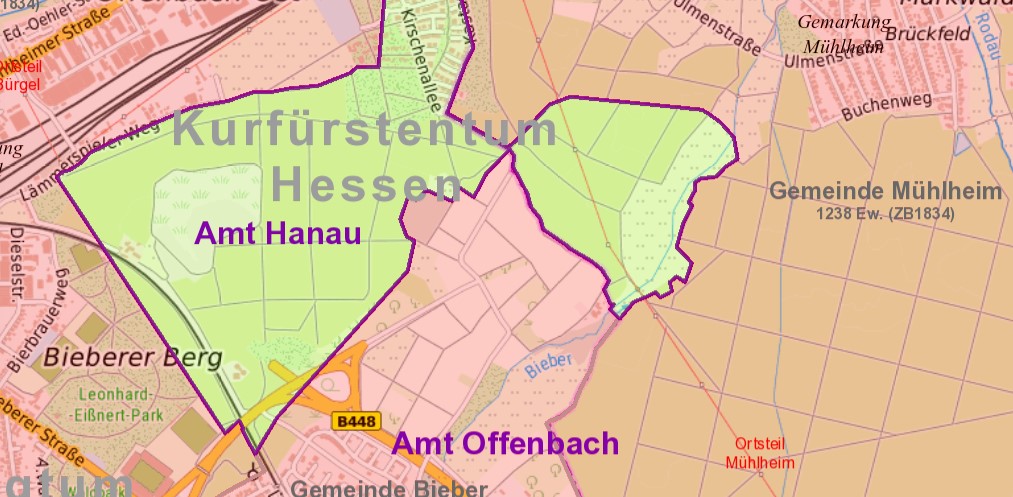 Es gibt mit der nachbarlichen Gemarkung
Rumpenheim eine historische Besonderheit: Die
Gemarkung Rumpenheim mit dem Schloss gehörte nicht zu Kurmainz
und zur
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum Großherzogtum
Hessen,
sondern zur Grafschaft Hanau-Münzenberg und dann zu
Hessen-Kassel bzw. Kurhessen. Erst 1866
kam es durch ein Gebietsaustausch
mit den siegreichen Preußen zum Großherzogtum. Die
Grenze
von Mühlheim war vor 1866 demnach eine Territorialgrenze. Und
es
gibt noch eine Besonderheit: die sog. Rumpenheimer Wiese war eine Art
Exklave im Gemarkungsgebiet von Mühlheim.
Es gibt mit der nachbarlichen Gemarkung
Rumpenheim eine historische Besonderheit: Die
Gemarkung Rumpenheim mit dem Schloss gehörte nicht zu Kurmainz
und zur
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum Großherzogtum
Hessen,
sondern zur Grafschaft Hanau-Münzenberg und dann zu
Hessen-Kassel bzw. Kurhessen. Erst 1866
kam es durch ein Gebietsaustausch
mit den siegreichen Preußen zum Großherzogtum. Die
Grenze
von Mühlheim war vor 1866 demnach eine Territorialgrenze. Und
es
gibt noch eine Besonderheit: die sog. Rumpenheimer Wiese war eine Art
Exklave im Gemarkungsgebiet von Mühlheim.Die Gemarkungsgrenze von Lämmerspiel und Hausen
5/22
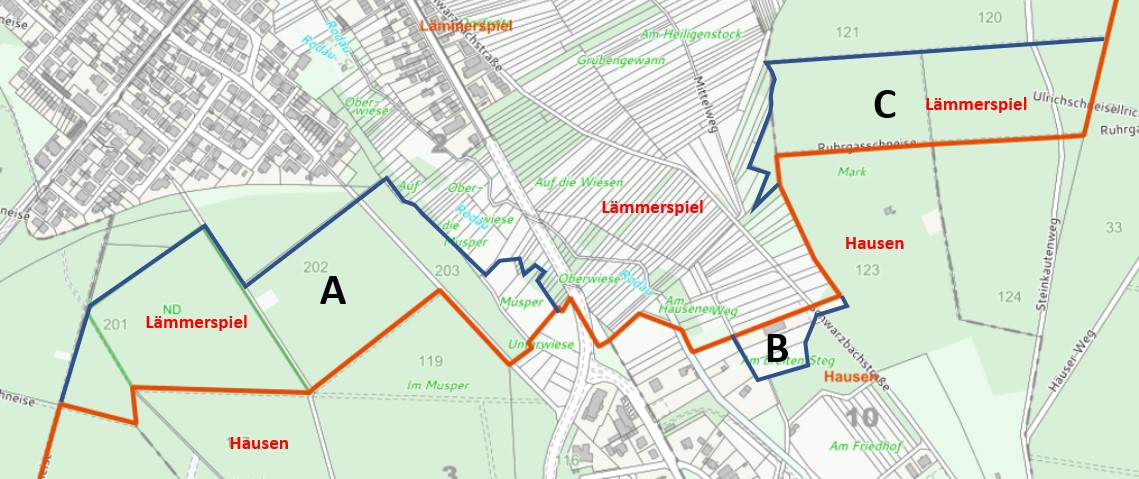 Auch
hier gab es in der Vergangenheit einige Grenzverschiebungen in Summe
zugunsten von Lämmerspiel. Die alten Grenzen können
eindeutig
auf den Grundstückskarten identifiziert werden. Die alte
Grenze im
Gebiet A folgen im westlichen Bereich den geraden Waldschneisen. Im
östlichen Bereich verläuft die Grenze am
völlig
zugewachsenen Waldrand entlang und dann bis zur Kreisstraße
über Wiesen. Dort konnte ich keine Steine finden, ebenso im
Bereich B, wo die Grenze zugunsten Hausens begradigt wurde. Zwischen
den Bereichen B und C ist der Grenzgraben von einem Begleitpfad gut zu
sehen. Die alte Grenze verläuft dann etwas erratisch der
früheren Waldgrenze entlang. Der gezackte Verlauf ist am
Grenzgraben deutlich zu erkennen. An einer 90 Grad Biegung findet man
den ersten historischen Stein. Wegen des starken Bewuchses musste ich
meine Expedition unterbrechen und auf 2023 verschieben. Luise Hubel hat
um 2005 dort weitere Grenzsteine finden können. Ich werde
berichten.
Auch
hier gab es in der Vergangenheit einige Grenzverschiebungen in Summe
zugunsten von Lämmerspiel. Die alten Grenzen können
eindeutig
auf den Grundstückskarten identifiziert werden. Die alte
Grenze im
Gebiet A folgen im westlichen Bereich den geraden Waldschneisen. Im
östlichen Bereich verläuft die Grenze am
völlig
zugewachsenen Waldrand entlang und dann bis zur Kreisstraße
über Wiesen. Dort konnte ich keine Steine finden, ebenso im
Bereich B, wo die Grenze zugunsten Hausens begradigt wurde. Zwischen
den Bereichen B und C ist der Grenzgraben von einem Begleitpfad gut zu
sehen. Die alte Grenze verläuft dann etwas erratisch der
früheren Waldgrenze entlang. Der gezackte Verlauf ist am
Grenzgraben deutlich zu erkennen. An einer 90 Grad Biegung findet man
den ersten historischen Stein. Wegen des starken Bewuchses musste ich
meine Expedition unterbrechen und auf 2023 verschieben. Luise Hubel hat
um 2005 dort weitere Grenzsteine finden können. Ich werde
berichten.Nachtrag 4/2023: Der o.g. Stein LSHA 40 am Rande des Bereich C stand am Besuchstermin unzugänglich in einem Feuchtgebiet. Man konnte aber dann den Grenzgraben mit typischen Eichenbewuchs weiter nach Norden folgen. Bis zur ehemaligen Nordgrenze der Hausener Gemarkung konnten vier unscheinbare Steine gefunden werden. Sie besitzen eine Grundfläche von 15 x 15 cm und sind auf der Westseite mit einem "G" (Gemarkung?) gekennzeichnet. Mindestens ein Stein besteht aus Beton: LSHA 45. Neben diesem steht in ca. 2 m Entfernung ein moderner Grenzstein.
Folgt man dem Grenzgraben weiter nach Norden passiert man zwei weitere Steine. Diese markierten wohl die Grenze zwischen Wald- und Feldflur. Frau Luise Hubel überließ mir eine Skizze des Gebietes, die für das Auffinden der Steine recht hilfreich war.
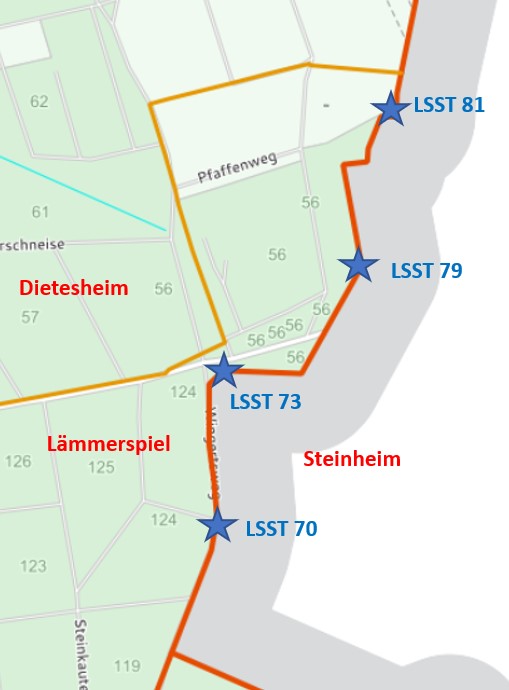
Die Gemarkungsgrenze von Lämmerspiel und Steinheim
4/23
Diese Grenze ist für einen Grenzsteinfreund nicht sehr ergiebig. Von LSST 70, dem südlichsten Stein, ist nur der Kopf zu sehen, der kaum aus dem Wegesboden herausragt. LSST 73, in der Nähe der Straße Lämmerspiel-Steinheim ist ein unscheinbarer 15 x 15 cm Stein, der leicht zu übersehen ist. Jetzt wird es interessanter: Der Grenzgraben wird tiefer und quert die genannte Straße. Am ersten Knick des Grabens steht dann sehr prägnant der unbehauene Stein LSST 79. Danach flacht der Grenzgraben ab und ist um Brombeergestrüpp kaum noch zu erkennen. An einem 90 Grad Knick konnte ich einen unregelmäßig geformten Stein finden, der kaum aus dem Boden schaute.
Die Gemarkungsgrenze von Dietesheim und Steinheim
5/23
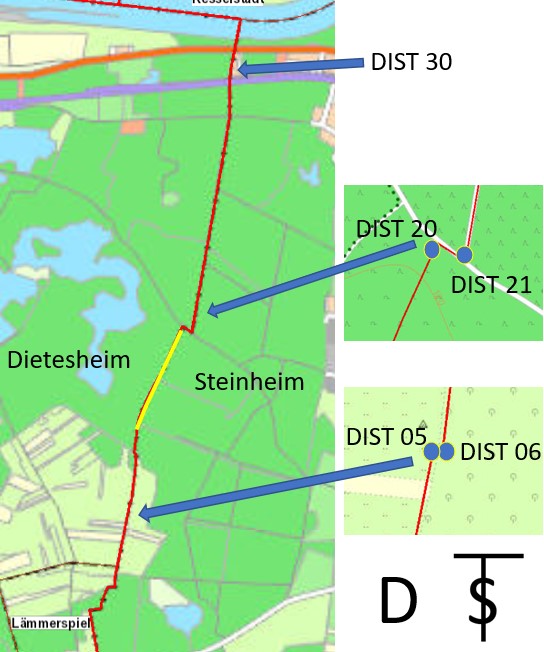 Die
Grenzlinie beginnt im Süden am unmarkierten
Berührungspunkt
der Gemarkungen Lämmerspiel, Dietesheim und Steinheim inmitten
schöner Streuobstwiesen. Diesen Punkt erreichten wir, indem
wir von der Verbindungsstraße
Lämmerspiel-Steinheim den asphaltierten Weg in der
Nähe
des Parkplatzes nach Norden gingen und vor dem Waldaustritt dem
schmalen Pfad in östlicher Richtung folgten (blauer Stern auf
der Karte).
Wir passierten einen modernen Grenzstein im Weg unter der
Hochspannungsleitung und kamen dann an einen Versatz der Grenze um ca.
6 Meter. Links und rechts des Wiesenweges standen zwei schöne
Grenzsteine aus Basalt. Sie sind beide mit einem "D" für
Dietesheim und den Zeichen für Steinheim versehen, einem "T"
mit
einem verschlungenen "S". Wir folgten dem Pfad Richtung Norden vorbei
an einem modernen Grenzstein bis wir auf einen Querweg
stießen,
wo der Pfad endete. Wir sind der Grenzlinie nicht weiter gefolgt, weil
kein Anhaltspunkt zu deren Verlauf erkennbar war. Der
nichtuntersuchte Teil der Grenze ist auf der
nebenstehenden Karte
gelb eingezeichnet. Erst über einem Umweg entlang des
Oberwaldsees
erreichten wir wieder die Grenzlinie. Hier schlägt die Grenze
erneut einen Haken, der Versatz beträgt ca. 40 Meter. An
diesen
Eckpunkten stehen zwei alte, unbeschriftete,
unregelmäßig
geformte Steine aus Basalt und Sandstein. Auf dem geraden Weg bis zur
Bahnlinie konnten wir erwartungsgemäß keine weiteren
Grenzsteine finden. Auf dem Grenzverlauf zwischen der Bahnlinie und dem
Main fand ich mit Hilfe von Anwohnern einen weiteren (unbeschrifteten)
Grenzstein aus Rotliegendem (Kreuz als Weisung) im Grenzgraben
südlich des Wohnhauses. Es handelt sich wahrscheinlich um
einen
Güterstein zur Grundstücksabgrenzung, der auf der
Gemarkungsgrenze steht. Der Grenzgraben ist auf der nördlichen
Seite der Bundesstraße zum Main hin deutlich zu erkennen.
Die
Grenzlinie beginnt im Süden am unmarkierten
Berührungspunkt
der Gemarkungen Lämmerspiel, Dietesheim und Steinheim inmitten
schöner Streuobstwiesen. Diesen Punkt erreichten wir, indem
wir von der Verbindungsstraße
Lämmerspiel-Steinheim den asphaltierten Weg in der
Nähe
des Parkplatzes nach Norden gingen und vor dem Waldaustritt dem
schmalen Pfad in östlicher Richtung folgten (blauer Stern auf
der Karte).
Wir passierten einen modernen Grenzstein im Weg unter der
Hochspannungsleitung und kamen dann an einen Versatz der Grenze um ca.
6 Meter. Links und rechts des Wiesenweges standen zwei schöne
Grenzsteine aus Basalt. Sie sind beide mit einem "D" für
Dietesheim und den Zeichen für Steinheim versehen, einem "T"
mit
einem verschlungenen "S". Wir folgten dem Pfad Richtung Norden vorbei
an einem modernen Grenzstein bis wir auf einen Querweg
stießen,
wo der Pfad endete. Wir sind der Grenzlinie nicht weiter gefolgt, weil
kein Anhaltspunkt zu deren Verlauf erkennbar war. Der
nichtuntersuchte Teil der Grenze ist auf der
nebenstehenden Karte
gelb eingezeichnet. Erst über einem Umweg entlang des
Oberwaldsees
erreichten wir wieder die Grenzlinie. Hier schlägt die Grenze
erneut einen Haken, der Versatz beträgt ca. 40 Meter. An
diesen
Eckpunkten stehen zwei alte, unbeschriftete,
unregelmäßig
geformte Steine aus Basalt und Sandstein. Auf dem geraden Weg bis zur
Bahnlinie konnten wir erwartungsgemäß keine weiteren
Grenzsteine finden. Auf dem Grenzverlauf zwischen der Bahnlinie und dem
Main fand ich mit Hilfe von Anwohnern einen weiteren (unbeschrifteten)
Grenzstein aus Rotliegendem (Kreuz als Weisung) im Grenzgraben
südlich des Wohnhauses. Es handelt sich wahrscheinlich um
einen
Güterstein zur Grundstücksabgrenzung, der auf der
Gemarkungsgrenze steht. Der Grenzgraben ist auf der nördlichen
Seite der Bundesstraße zum Main hin deutlich zu erkennen. Der oben erwähnte gerade Weg bis zum Main war früher die Grenze zwischen Dietesheim und der selbstständigen Gemeinde Klein-Steinheim, die 1938 mit Groß-Steinheim zu Steinheim zusammengelegt wurde. 1974 kam Steinheim dann zur Stadt Hanau.



Die Gemarkungsgrenze von Mühlheim und Dietesheim
6/23 - 4/25

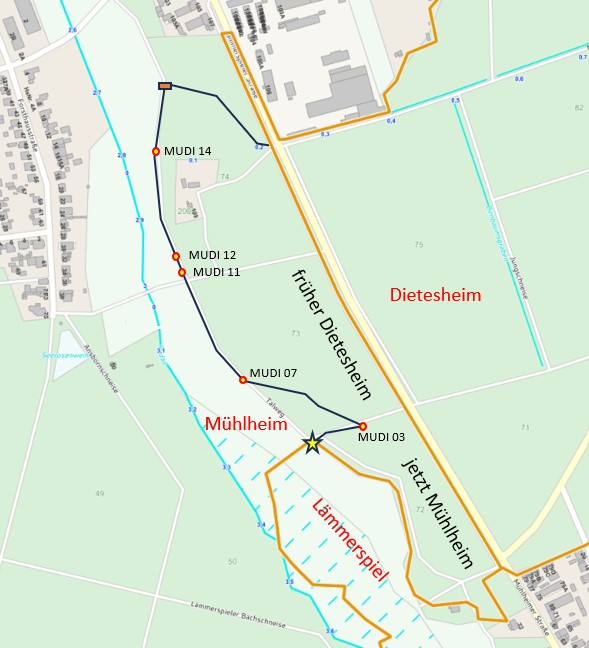 Dietesheim
ist seit 1939 ein Stadtteil von Mühlheim. Es
handelt sich bei der Grenze beider Gemarkungen östlich der
Lämmerspieler Straße um eine recht komplex
verlaufende
Grenzlinie vom
Main im Norden durch bebautes Gebiet bis zur Lämmerspieler
Gemarkung. Erwartungsgemäß waren in den Wiesen am
Main keine
Grenzsteine zu finden. Den Spaziergang durch
Mühlheim-Dietesheim
habe ich mir erspart. Die komplizierte Grenzlinie an der
Straße
Mühlheim Lämmerspiel verlauft an zugewachsenen
Waldrändern. Hier hatte ich keine Chance, irgendwelche
historischen Grenzsteine zu finden. Meine Hoffnung lag in dem
Grenzverlauf zwischen Südring und der neuen Schneise. Die
Topografie entsprach einer typischen Grenze: Grenzweg, alte Eichen im
Verlauf, deutlich erkennbare Grenzpunkte. Leider konnte ich dort bis
zur aktuellen Grenze entlang der Lämmerspieler
Straße
ebenfalls keine steinernen Grenzmarkierungen finden.
Dietesheim
ist seit 1939 ein Stadtteil von Mühlheim. Es
handelt sich bei der Grenze beider Gemarkungen östlich der
Lämmerspieler Straße um eine recht komplex
verlaufende
Grenzlinie vom
Main im Norden durch bebautes Gebiet bis zur Lämmerspieler
Gemarkung. Erwartungsgemäß waren in den Wiesen am
Main keine
Grenzsteine zu finden. Den Spaziergang durch
Mühlheim-Dietesheim
habe ich mir erspart. Die komplizierte Grenzlinie an der
Straße
Mühlheim Lämmerspiel verlauft an zugewachsenen
Waldrändern. Hier hatte ich keine Chance, irgendwelche
historischen Grenzsteine zu finden. Meine Hoffnung lag in dem
Grenzverlauf zwischen Südring und der neuen Schneise. Die
Topografie entsprach einer typischen Grenze: Grenzweg, alte Eichen im
Verlauf, deutlich erkennbare Grenzpunkte. Leider konnte ich dort bis
zur aktuellen Grenze entlang der Lämmerspieler
Straße
ebenfalls keine steinernen Grenzmarkierungen finden. Zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass die Grenze zwischen beiden Gemarkungen früher nicht entlang der Lämmerspieler Straße führte, sondern weiter westlich am Waldrand entlang. Die Abbildung rechts zeigt den vermuteten Grenzverlauf zwischen Mühlheim und Dietesheim (blaue Linie). Der Stern markiert den Berührungspunkt der Mühlheimer, Dietesheimer und


 Lämmerspieler
Gemarkungen. Hier
steht ein Dreimärker, der an anderer Stelle beschrieben wird.
Alten Messtischblättern ist zu entnehmen, dass der jetzt
baumbestandene "Zwickel" früher unbewaldet war und zum
Wiesengelände gehörte. An der Spitze dieses Zwickels
steht
links des Grenzsteins mit der Inschrift "M" und "D". Jetzt kann man
einem Graben durch dichtes Gebüsch folgen. Ich konnte dort
außer einem unmarkiertem Läuferstein keine weiteren
Steine finden. An der Stelle, wo der Graben auf den Talweg
trifft, wurde ein sorgfältig behauener Stein mit der Inschrift
"G"
gesetzt. Auf der östlichen Seite des Grabens, der den Talweg
begleitet findet man noch drei weitere mit "M" gekennzeichneten Steine.
An der Spitze des oben eingezeichneten alten Grenzverlaufs findet man
zwei
neuere Grenzmarkierungen. Dies ist die Stelle, an der der von
Südosten kommende Grenzgraben auf den Talweg trifft.
Möglicherweise steht an dem Knick des Grenzgrabens ein
weiterer
Stein, der aber wegen des starken Bewuchses für mich nicht
zugänglich war. Die Abbildungen zeigen die Steine MUDI 03,
MUDI 07
und MUDI 11
Lämmerspieler
Gemarkungen. Hier
steht ein Dreimärker, der an anderer Stelle beschrieben wird.
Alten Messtischblättern ist zu entnehmen, dass der jetzt
baumbestandene "Zwickel" früher unbewaldet war und zum
Wiesengelände gehörte. An der Spitze dieses Zwickels
steht
links des Grenzsteins mit der Inschrift "M" und "D". Jetzt kann man
einem Graben durch dichtes Gebüsch folgen. Ich konnte dort
außer einem unmarkiertem Läuferstein keine weiteren
Steine finden. An der Stelle, wo der Graben auf den Talweg
trifft, wurde ein sorgfältig behauener Stein mit der Inschrift
"G"
gesetzt. Auf der östlichen Seite des Grabens, der den Talweg
begleitet findet man noch drei weitere mit "M" gekennzeichneten Steine.
An der Spitze des oben eingezeichneten alten Grenzverlaufs findet man
zwei
neuere Grenzmarkierungen. Dies ist die Stelle, an der der von
Südosten kommende Grenzgraben auf den Talweg trifft.
Möglicherweise steht an dem Knick des Grenzgrabens ein
weiterer
Stein, der aber wegen des starken Bewuchses für mich nicht
zugänglich war. Die Abbildungen zeigen die Steine MUDI 03,
MUDI 07
und MUDI 11Die Gemarkungsgrenze von Mühlheim und Lämmerspiel
5/23 - 4/25
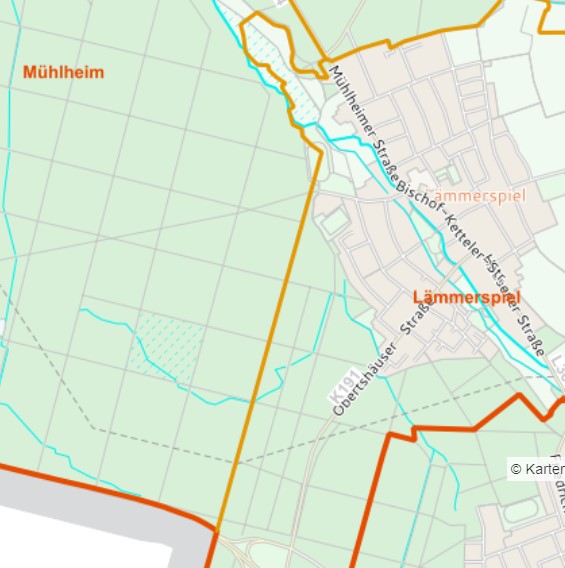 Die
Grenzlinie startet im Süden an der B 448 und folgt einem
Waldweg
schnurgerade für 1,3 Kilometer bis zum Sportzentrum
Lämmerspiel, Dort sind keine Grenzsteine zu erwarten, daher
habe
ich auf die Begehung dieses Weges verzichtet. Weiter nördlich
mäandert die Grenze über eine große Wiese
und endet an
einem Dreimärker, an dem sie an die ehemalige Gemarkungsgrenze
von
Dietesheim und die von Lämmerspiel stößt.
Auf dem
Grenzverlauf konnte
ich nur einen Stein mit der Inschrift "F" ausmachen, der mir einiges
Kopfzerbrechen verursachte. F = Fiskus? Feldgemarkung? Bisher konnte
ich keine eindeutige Begründung finden. Etwas Licht
in das
Dunkel brachte eine Karte
von Luise Hubel.
Hier waren mehrere Steine nordwestlich dieses F-Steins eingetragen.
Beim Nachforschen konnte ich drei dieser Steine finden und alle drei
waren ebenfalls mit "F" gekennzeichnet. Es muss also einen Zusammenhang
zu dem F-Stein LSBMMU in der Wiese geben.
Die
Grenzlinie startet im Süden an der B 448 und folgt einem
Waldweg
schnurgerade für 1,3 Kilometer bis zum Sportzentrum
Lämmerspiel, Dort sind keine Grenzsteine zu erwarten, daher
habe
ich auf die Begehung dieses Weges verzichtet. Weiter nördlich
mäandert die Grenze über eine große Wiese
und endet an
einem Dreimärker, an dem sie an die ehemalige Gemarkungsgrenze
von
Dietesheim und die von Lämmerspiel stößt.
Auf dem
Grenzverlauf konnte
ich nur einen Stein mit der Inschrift "F" ausmachen, der mir einiges
Kopfzerbrechen verursachte. F = Fiskus? Feldgemarkung? Bisher konnte
ich keine eindeutige Begründung finden. Etwas Licht
in das
Dunkel brachte eine Karte
von Luise Hubel.
Hier waren mehrere Steine nordwestlich dieses F-Steins eingetragen.
Beim Nachforschen konnte ich drei dieser Steine finden und alle drei
waren ebenfalls mit "F" gekennzeichnet. Es muss also einen Zusammenhang
zu dem F-Stein LSBMMU in der Wiese geben.  Ich
habe nun folgende Vermutung, die auf dem Betrachten der Grundstücksgrenzen
beruht: Die Grenze der Biebermark-Waldungen verlief im Norden
entlang der rot gezeichneten Linie (auf der rechten Abbildung). Sie war
mit den F-Steinen gekennzeichnet. Am Grenzpunkt LSBMMU traf sie auf die
Lämmerspieler Grenze. Das mit X bezeichnete Gebiet gehörte
früher zur Biebermark
und war bewaldet. Bei der Waldmarkteilung erhielt Mühlheim
diesen Teil der Biebermark.
Die F-Steine waren jetzt nur noch
Ich
habe nun folgende Vermutung, die auf dem Betrachten der Grundstücksgrenzen
beruht: Die Grenze der Biebermark-Waldungen verlief im Norden
entlang der rot gezeichneten Linie (auf der rechten Abbildung). Sie war
mit den F-Steinen gekennzeichnet. Am Grenzpunkt LSBMMU traf sie auf die
Lämmerspieler Grenze. Das mit X bezeichnete Gebiet gehörte
früher zur Biebermark
und war bewaldet. Bei der Waldmarkteilung erhielt Mühlheim
diesen Teil der Biebermark.
Die F-Steine waren jetzt nur noch  Gütersteine.
Jetzt kommt die Rodau ins Spiel: Das Gebiet X zwischen der Grenze zu
Lämmerspiel und der Rodau wurde gerodet und an
Mühlheimer
Bürger verteilt. Und das Gebiet östlich der F-Steine
bis zur
Rodau wurde aufgeforstet. Diese These harrt noch der
Bestätigung
durch die lokalen Spezialisten.
Gütersteine.
Jetzt kommt die Rodau ins Spiel: Das Gebiet X zwischen der Grenze zu
Lämmerspiel und der Rodau wurde gerodet und an
Mühlheimer
Bürger verteilt. Und das Gebiet östlich der F-Steine
bis zur
Rodau wurde aufgeforstet. Diese These harrt noch der
Bestätigung
durch die lokalen Spezialisten. Die Gemarkungsgrenze von Lämmerspiel und Dietesheim
Diese Grenze kann man in drei Abschnitte einteilen. Abschnitt A ist mit neun Grenzsteinen gut bestückt, in Abschnitt B entdeckte ich sechs Steine, während in Abschnitt C kein Grenzstein zu finden war.


Abschnitt A
Wie im Kapitel weiter oben berichtet verlief früher die Grenze zu Dietesheim in diesem Abschnitt nicht an der Lämmerspieler Straße, sondern an der jetzigen Gemarkungsgrenze zu Mühlheim. Beginnen wir die Grenzsteintour an der ehemaligen Berührungsstelle der Gemarkungen von Lämmerspiel, Mühlheim und Dietesheim. Dort steht ein auf der Karte mit einem Stern markieren Dreimärker. Drei von
 seinen
vier Kanten sind
seinen
vier Kanten sind beschriftet: Jeweils ein M, D und L in einem Dreieck. Das habe ich in dieser Form noch nie gesehen. Die andern Steine LSDI 02 bis 10 (LSDI 04 fehlt) sind mit "L" und "D" beschriftet. sie sind recht unspektakulär: Basalt, nur grob in Form gehauen, Beschriftung etwas ungelenk. Anmerkung: Der Stein LSDI 10 steht westlich des Wegs (Ungenauigkeit in der Kartendarstellung).
Abschnitt B
Auf der Grenzlinie hinter der Bebauung waren erwartungsgemäß keine Steine zu finden. Auch weiter östlich dem Graben entlang bis zum Lämmespieler Fahrradparcour-Platz war Fehlanzeige. Von dort war es praktisch unmöglich, dem Graben weiter zu folgen, so dicht war der Dornenbewuchs. Ich versuchte mehrmals vergeblich über die feuchte Wiese durch das Gestrüpp in den Wald zu kommen, denn mich interessierte die Ausstülpung der Grenze nach Norden. Erst als ich an einem

 Wildwechsel einen
Durchlass freischneiden konnte, gelang es
mir, zum Grenzgraben vorzudringen. Hier das gleiche Bild. Es war eher
Zufall, dass ich bis zum Stein LSDI 30 vordringen konnte (Abb. links).
Dieser steht
am Knick der Grenze nach Norden. Ich lief dann über die Wiese
zu
dem Punkt, wo die Grenze nach Süden über die Wiese
abknickte.
Dort lag ein Grenzstein mit der Inschrift "G" (LSDI 40, Abb. links).
Der Versuch von dort aus
nach Westen an die Ausstülpung zu gelangen, scheiterte
wiederum an
dem dichten Bewuchs. Wenn man dem Graben weiter nach Osten folgt,
stößt man an dem Wieseneck auf einen
schönen
Trigonometrischen Stein mit "TP und Dreieck.
Wildwechsel einen
Durchlass freischneiden konnte, gelang es
mir, zum Grenzgraben vorzudringen. Hier das gleiche Bild. Es war eher
Zufall, dass ich bis zum Stein LSDI 30 vordringen konnte (Abb. links).
Dieser steht
am Knick der Grenze nach Norden. Ich lief dann über die Wiese
zu
dem Punkt, wo die Grenze nach Süden über die Wiese
abknickte.
Dort lag ein Grenzstein mit der Inschrift "G" (LSDI 40, Abb. links).
Der Versuch von dort aus
nach Westen an die Ausstülpung zu gelangen, scheiterte
wiederum an
dem dichten Bewuchs. Wenn man dem Graben weiter nach Osten folgt,
stößt man an dem Wieseneck auf einen
schönen
Trigonometrischen Stein mit "TP und Dreieck.Auf dem Knickpunkt der Grenze auf der Wiese konnte ich kein Stein finden, ebenso wenig wie am anderen Knickpunkt im Wald (wiederum sehr starker Bewuchs). Am nächsten Grenzpunkt war Stein LSDI 43 zu entdecken. An den nächsten beiden Grenzknicks: negativ. Bis zur Straße Lämmerspiel - Steinheim gab es noch zwei weitere Steine am Graben.
Abschnitt C
Der nördliche Rand der Straße bildet die Grenze zwischen den Lämmerspieler und Dietesheimer Wald. Der Verlauf ist eine Folge der Markwaldteilung. Das Gebiet in der Ausstülpung der Lämmerspieler Gemarkung nach Norden war kein Markwald; es handelte sich um Äcker, die Privatpersonen, wahrscheinlich aus Lämmerspiel, gehörten. Es ist heute teilweise bewaldet. Bemerkenswert ist, dass dieses Gebiet durch einen Waldstreifen mit der Hauptgemarkung verbunden ist, durch den die Straße nach Steinheim führt. An diesem Grenzverlauf konnte ich trotz intensiver Suche keine Steine finden.
Die Gemarkungsgrenze von Mühlheim mit Rumpenheim
6/23 und 1/25 MURU.gpx
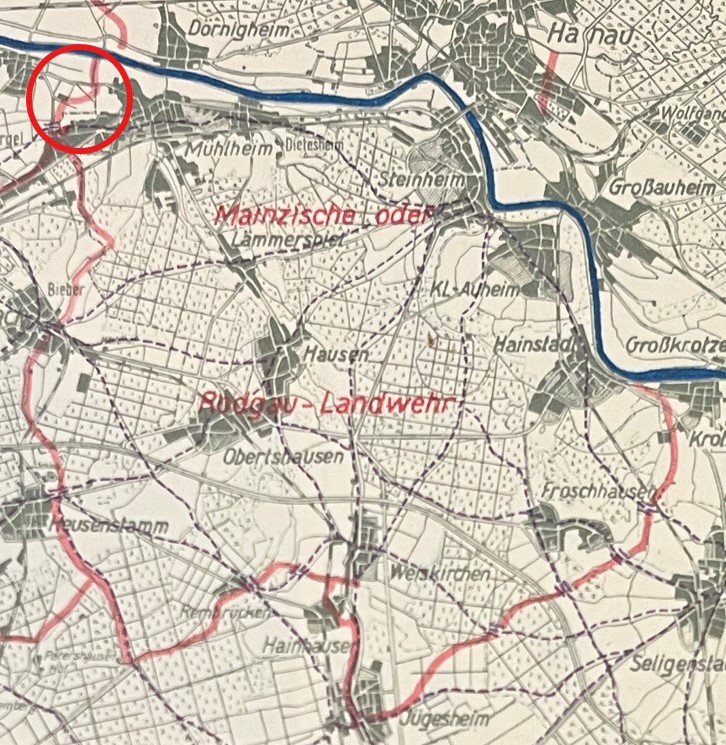
 Im
Kreis Offenbach gibt es zwei Landwehren, die durch eine
Verbindungslandwehr miteinander verbunden sind: Die Dreieicher
Ringlandwehr (über die auf dieser Website ausführlich
berichtet wird) und die Rodgau- oder Mainzer Landwehr im Nordosten des
Kreisgebietes (Abb. links aus dem Nahrgang-Atlas). Einige Strecken
dieser Landwehr sind teilweise heute
noch mit Grenzsteinen markierte Gemarkungsgrenzen. In diesem
Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Abschnitt dieser Landwehr
vom Main über die ehemalige Rote Warte und weiter bis in die
Gegend der Käsmühle. Die Rote Warte war ein
befestigter Turm an der Grenze des Mainzischen und Hanauer Territoriums
zur Zollerhebung an der alten Geleitstraße von Frankfurt in
den
Südwesten Deutschlands. Sehr schön ist dieser
Landwehrabschnitt auf einer Karte aus dem Staatsarchiv
Würzburg "Riß
über die Bieger Mark"
aus dem Jahr 1580 als dichte Hecke zwischen Main und der Roten Warte zu
erkennen. Der Abschnitt vom Main bis ungefähr bis zur
Käsmühle bildet heute die Gemarkungsgrenze von
Mühlheim
und Rumpenheim.
Im
Kreis Offenbach gibt es zwei Landwehren, die durch eine
Verbindungslandwehr miteinander verbunden sind: Die Dreieicher
Ringlandwehr (über die auf dieser Website ausführlich
berichtet wird) und die Rodgau- oder Mainzer Landwehr im Nordosten des
Kreisgebietes (Abb. links aus dem Nahrgang-Atlas). Einige Strecken
dieser Landwehr sind teilweise heute
noch mit Grenzsteinen markierte Gemarkungsgrenzen. In diesem
Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Abschnitt dieser Landwehr
vom Main über die ehemalige Rote Warte und weiter bis in die
Gegend der Käsmühle. Die Rote Warte war ein
befestigter Turm an der Grenze des Mainzischen und Hanauer Territoriums
zur Zollerhebung an der alten Geleitstraße von Frankfurt in
den
Südwesten Deutschlands. Sehr schön ist dieser
Landwehrabschnitt auf einer Karte aus dem Staatsarchiv
Würzburg "Riß
über die Bieger Mark"
aus dem Jahr 1580 als dichte Hecke zwischen Main und der Roten Warte zu
erkennen. Der Abschnitt vom Main bis ungefähr bis zur
Käsmühle bildet heute die Gemarkungsgrenze von
Mühlheim
und Rumpenheim. Rumpenheim war vor 1866 Teil von Kurhessen und vor 1836 Teil der Grafschaft Hanau-Münzenberg. Es grenzte im Osten an Mühlheim, im Westen an Bürgel und im Süden an Bieber. Eine Besonderheit war eine Exklave im Mühlheimer Gebiet, die "Rumpenheimer Wiese" (RW auf der Karte unten). Nach der Annexion des Kurfürstentums durch die Preußen, wurde das südmainische Rumpenheim durch Gebietsaustausch dem Großherzogtum Hessen zugeordnet. Bürgel kam 1908 zu Offenbach, Bieber 1938 und Rumpenheim 1943. Die Rumpenheimer Wiese (s.u.) gelangte irgendwann in die Mühlheimer Gemarkung.
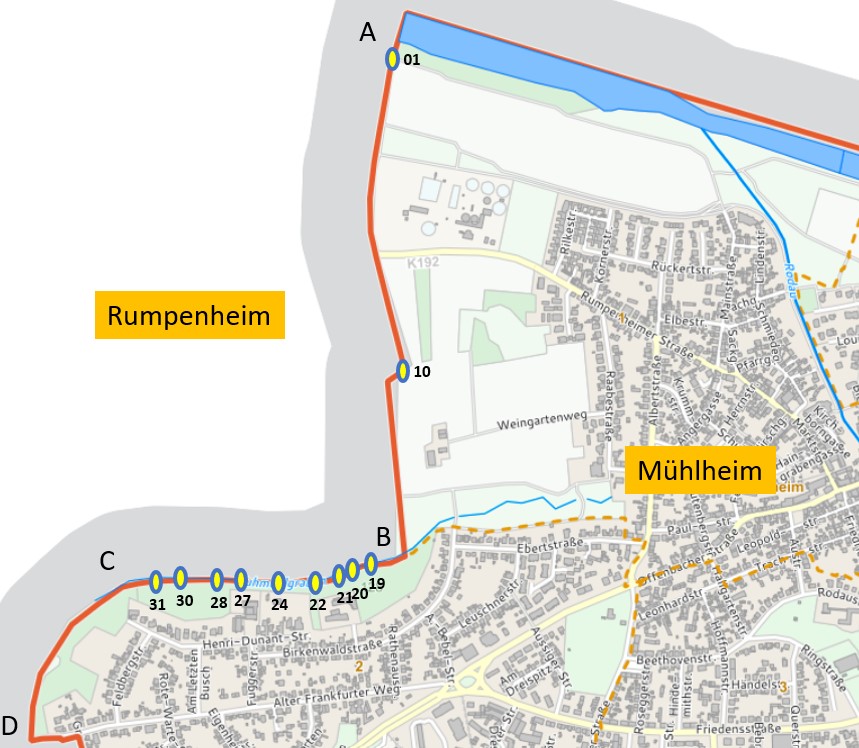
Die Grenze lässt sich in mehrere Abschnitte unterteilen: Vom Main senkrecht nach Süden (A-B), entlang des Kuhmühlgrabens nach Westen (B-C), der Abbiegung nach Süden (C-D) und dem weitere Verlauf bis zur Rumpenheimer Wiese.
Im Norden der Grenze von Mühlheim und Rumpenheim stehen am Mainuferweg zwei Regionalparkstelen mit Erläuterungen zur Rodgauer Landwehr. Wenige Meter von den Stelen entfernt findet man einen Grenzstein aus Basalt mit rundgewöbtem Kopf und der Inschrift "NO I " auf der Ostseite (= Mühlheimer Seite). Das "N" ist spiegelverkehrt angelegt, nicht ungewöhnlich für alte Grenzsteine. Und: Wenn es einen Stein mit der Nummer 1 gibt, dann wird es wohl noch weitere geben. Abb. rechts aus dem Bürger-GIS.
Folgen wir der Grenze Richtung Süden auf einem asphaltiertem Weg zunächst parallel der Landwehrhecke, dann entlang eines Zaunes, hinter dem sich ein Teich verbirgt, bis zur Straße Mühlheim-Rumpenheim: Keine Grenzsteine. Südlich der Straße verläuft die Grenze in einem undurchdringlichen Brombeergestrüpp. Ich hatte die Hoffnung, an den beiden markanten Knicks der Grenze Steine zu finden. Zu meiner Überraschung entdeckte ich nach der Freischneidung einer Lücke in der Hecke den Stein NO 10. Der Stein NO 11 ist nicht mehr vorhanden, er hätte auf einer bewirtschafteten Ackerfläche gestanden. Die Grenze verläuft gradlinig weiter nach Süden bis zum Kuhmühlgraben. Früher hatte die Grenze noch eine Ausbuchtung, wie einem alten Messtischblatt zu entnehmen ist. Bis zum Kuhmühlgraben konnte ich keine Steine mehr finden.
Der Grenzabschnitt entlang des Kuhmühlgrabens ist von Ende der Ebertstraße/Birkenwaldstraße gut erreichbar. Ein Pfad führt entlang des Grabens auf dessen südlicher Seite. Der erste Grenzstein NO 19 ist vom Pfad nicht zu erkennen, er steht in einer dichten Brombeerhecke uns ist nur von der anderen Seite des Grabens sichtbar. Dafür ist Stein NO 20 nicht zu übersehen. Er hängt sehr stark nach Westen. Mit Hilfe einer Schaufel war die Beschriftung gut erkennbar.
Ganz in der Nähe steht der Stein mit der Inschrift NO 21 auf der südlichen Seite des Pfades. Sehr schön ist die Inschrift des Steines NO 22 zu erkennen. Stein NO 23 konnte nicht gefunden werden. Die Inschrift von Stein NO 24 ist nur zu erahnen. Stein NO 27 steht am Fuße einer Eiche. Stein NO 28 steht sehr dominant am Graben. Die Inschrift ist ebenfalls stark verwittert. Die Steine NO 30 und NO 31 konnte ich wegen des Bewuchses nur von der Nordseite des Grabens entdecken. Der Stein NO 31 ist der letzte Stein, den ich auf dieser Grenzlinie bis zur Alten Frankfurter Straße (ehemaliger Standort der Roten Warte) gefunden habe. Die Grenze verläuft in einem fast undurchdringlichen Gestrüpp mit stacheligen Büschen und umgestürzten Bäumen.

Nachtrag 3/25: Bei einem erneuten Besuch des Gebietes nördlich der Roten Warte bemerke ich, dass die Ostseite des Kuhmühlgrabens teilweise freigeschnitten war. Mit großer Mühe konnte ich dann die Steine NO 33 und NO 35 im Gestrüpp ca. 5 Meter vom Graben entfernt mit Hilfe von GPS finden. Stein No 37 steht auf einer Wiese, markiert und geschützt von einem Busch, während Stein NO 38 wiederum nur sehr schwer im Unterholz zu finden ist.
 Das Jahr der
Steinsetzung auf dieser Grenzlinie ist mir nicht bekannt. Die grob und
uneinheitlich gehauenen Steine, verbunden mit den ungelenken
Inschriften deuten auf ein Besteinung im 17. Jh. hin. In den mir
zugänglichen Archiven konnte ich nichts darüber
finden. Ich hoffe, dass
sich jemand auf Nachsuche begibt, denn es ist nicht
ausgeschlossen, dass ich einige Steine übersehen habe.
Das Jahr der
Steinsetzung auf dieser Grenzlinie ist mir nicht bekannt. Die grob und
uneinheitlich gehauenen Steine, verbunden mit den ungelenken
Inschriften deuten auf ein Besteinung im 17. Jh. hin. In den mir
zugänglichen Archiven konnte ich nichts darüber
finden. Ich hoffe, dass
sich jemand auf Nachsuche begibt, denn es ist nicht
ausgeschlossen, dass ich einige Steine übersehen habe. Von der ehemaligen Roten Warte verläuft die Gemarkungsgrenze der Grenzstraße und der Senefelder Straße entlang und quert die Eisenbahnlinie Offenbach-Hanau. Auf der anderen Seite begrenzt sie das Neubaugebiet gegen die Kleingärten im Osten. Nach dem Kreisel folgen wir der Kirschenallee bis deren Biegung nach rechts. An dieser Stelle berührte die Rumpenheimer Gemarkung die Rumpenheimer Wiese, eine Exklave auf Mühlheimer Gemarkung, die heute z.T. bewaldet ist. Das Gebiet ist auf der Karte aus dem mit "RW bezeichnet. Es handelt sich um die Siedlungsentwicklungskarte der RheinMainRegion
Hier trifft die Grenze auch die Bieberer Gemarkung. Und hier wird es wieder spannend. Von Luise Hubel erhielt ich eine Karte des Gebietes um die Käsmühle mit den Grenzen und Grenzsteinen, die ich im Frühjahr 2026 aufsuchen möchte.
 Nun
ja, ich konnte es nicht lassen und bin Ende April 2025 die
westliche Seite der Rumpenheimer Exklave abgelaufen. Dabei ist
anzumerken, dass es sich bei diesem Rumpenheimer Gebiet sich nicht nur
um eine Wiese handelt, sondern auch um Wald, genauer gesagt um
ehemaligen Markwald. Der interessanten Frage, wie es zu dieser Exklave
gekommen ist, konnte ich leider nicht nachgehen. Auf der Karte von
Luise Hubel ist unten die Käsmühle eingetragen, der
Ausgangspunkt für die Suche nach den Grenzsteinen.
Nun
ja, ich konnte es nicht lassen und bin Ende April 2025 die
westliche Seite der Rumpenheimer Exklave abgelaufen. Dabei ist
anzumerken, dass es sich bei diesem Rumpenheimer Gebiet sich nicht nur
um eine Wiese handelt, sondern auch um Wald, genauer gesagt um
ehemaligen Markwald. Der interessanten Frage, wie es zu dieser Exklave
gekommen ist, konnte ich leider nicht nachgehen. Auf der Karte von
Luise Hubel ist unten die Käsmühle eingetragen, der
Ausgangspunkt für die Suche nach den Grenzsteinen. Sie beginnt an der großen Wegekreuzung nordöstlich des Gasthauses, an der man wenige Meter im Wald den Stein MURU 110 finden kann. Er besteht aus Basalt und ist einseitig (Südost-Seite) mit einem "M" gekennzeichnet. Der Stein MURU 109 war ohne GPS-Unterstützung kaum zu finden. Er ist aus rotem Sandstein gefertigt und mit "KH" und auf der anderen Seite mit "GH" als Inschriften versehen. Den Stein 108
 konnte
ich nicht finden, sein
Standplatz war durch einen umgestürzten Baum nicht
zugänglich.
Man erreicht dann einen wassergefüllten Graben, an dessen Rand
Stein MURU 107 zu finden ist, gefertigt aus Sandstein und mit der
Inschrift KH / GH versehen. Das gleiche gilt für MURU 106.
MURU 105 schaut nur wenig aus dem Boden, währen MURU 104
aufrecht unter einem umgestürzten Baum steht (Abb.). Man folgt
jetzt dem nahe vorbeiführenden schmalem Weg weiter nordwestlich
bis zum breiteren Bieberer Weg, wendet sich nach rechts und biegt nach
200 m nach rechts in einen schmalen Pfad ab. Nach 40 m kommt man an den
Stein MURU 144, einem einfachen Basaltquader mit einem "G" für
Gemarkung. 130 Meter weiter ostwärts entlang des Pfades
findet man einen herausliegenden Sandstein mit gewölbten Kopf.
Jetzt geht es nicht weiter; der Bewuchs ist undurchdringlich. Die auf
der Hubel-Karte mit 142, 141, 140 und 139 (letzterer auf der Wiese)
gekennzeichneten Stene konnte ich nicht finden.
konnte
ich nicht finden, sein
Standplatz war durch einen umgestürzten Baum nicht
zugänglich.
Man erreicht dann einen wassergefüllten Graben, an dessen Rand
Stein MURU 107 zu finden ist, gefertigt aus Sandstein und mit der
Inschrift KH / GH versehen. Das gleiche gilt für MURU 106.
MURU 105 schaut nur wenig aus dem Boden, währen MURU 104
aufrecht unter einem umgestürzten Baum steht (Abb.). Man folgt
jetzt dem nahe vorbeiführenden schmalem Weg weiter nordwestlich
bis zum breiteren Bieberer Weg, wendet sich nach rechts und biegt nach
200 m nach rechts in einen schmalen Pfad ab. Nach 40 m kommt man an den
Stein MURU 144, einem einfachen Basaltquader mit einem "G" für
Gemarkung. 130 Meter weiter ostwärts entlang des Pfades
findet man einen herausliegenden Sandstein mit gewölbten Kopf.
Jetzt geht es nicht weiter; der Bewuchs ist undurchdringlich. Die auf
der Hubel-Karte mit 142, 141, 140 und 139 (letzterer auf der Wiese)
gekennzeichneten Stene konnte ich nicht finden.  Um
die Steine auf der anderen Seite des Bieberbachs aufzusuchen, geht man
zurück an den Ausgangspunkt an der Käsmühle und
überquert den Bieberbach. Südwestlich des Weges kann man den
Stein MURU 120 finden, der mit "GH" und "KH" beschriftet ist. Den Stein
MURU 119 konnte ich nicht finden. Jetzt geht es auf die andere
(nordöstliche) Seite des Wegs. Der Grenzverlauf ist recht komplex.
.......
Um
die Steine auf der anderen Seite des Bieberbachs aufzusuchen, geht man
zurück an den Ausgangspunkt an der Käsmühle und
überquert den Bieberbach. Südwestlich des Weges kann man den
Stein MURU 120 finden, der mit "GH" und "KH" beschriftet ist. Den Stein
MURU 119 konnte ich nicht finden. Jetzt geht es auf die andere
(nordöstliche) Seite des Wegs. Der Grenzverlauf ist recht komplex.
.......Die Grenze Mühlheim - Bieber
 Diese Grenze beginnt
an dem ehemaligen Berührungspunkt der Rumpenheimer Wiese und
der Gemarkung Rumpenheim, auf der Karte mit einem blauen Stern
markiert. Sie folgt dem Verlauf der Rodgau-Landwehr, die hier bis zur
Käsmühle gut durch Wall und Graben erkennbar ist. Die
Grenze ist mit Basaltsteinen markiert. Sie haben eine
Grundfläche von 20x20 cm, einen geraden Kopf, haben keine
Weisung und sind mit einem "G" gekennzeichnet, das in unterschiedliche
Richtungen weist. Auf der Strecke zwischen dem blauen Kreuz und der
Käsmühle habe ich bei der Begehung am 22.01.1026 nur
einen Stein gefunden.
Diese Grenze beginnt
an dem ehemaligen Berührungspunkt der Rumpenheimer Wiese und
der Gemarkung Rumpenheim, auf der Karte mit einem blauen Stern
markiert. Sie folgt dem Verlauf der Rodgau-Landwehr, die hier bis zur
Käsmühle gut durch Wall und Graben erkennbar ist. Die
Grenze ist mit Basaltsteinen markiert. Sie haben eine
Grundfläche von 20x20 cm, einen geraden Kopf, haben keine
Weisung und sind mit einem "G" gekennzeichnet, das in unterschiedliche
Richtungen weist. Auf der Strecke zwischen dem blauen Kreuz und der
Käsmühle habe ich bei der Begehung am 22.01.1026 nur
einen Stein gefunden.  Man überquert die Bieber und
wendet sich dann nach links. Vorbei an dem ehemaligen
Landesgrenzstein MURU 120 erreicht man wieder die Grenze
Mühlheim - Bieber. Hier stehen weitere sechs Gemarkungssteine
in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Die Grenze führt entlang des
Waldrandes und ist an einer kleinen Bodenwelle erkennbar. An
dem markanten Knick der Grenze nach Südosten findet man keine spezifische Markierung.
Den weiteren Verlauf der Grenze habe ich nur stichprobenartig
aufgesucht und keine weiteren Grenzsteine gefunden. Den Unterlagen von
Luise Hubel ist zu entnehmen, dass ich möglicherweise zwei
oder drei Steine trotz sorgfältigem Suchen übersehen
habe.
Man überquert die Bieber und
wendet sich dann nach links. Vorbei an dem ehemaligen
Landesgrenzstein MURU 120 erreicht man wieder die Grenze
Mühlheim - Bieber. Hier stehen weitere sechs Gemarkungssteine
in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Die Grenze führt entlang des
Waldrandes und ist an einer kleinen Bodenwelle erkennbar. An
dem markanten Knick der Grenze nach Südosten findet man keine spezifische Markierung.
Den weiteren Verlauf der Grenze habe ich nur stichprobenartig
aufgesucht und keine weiteren Grenzsteine gefunden. Den Unterlagen von
Luise Hubel ist zu entnehmen, dass ich möglicherweise zwei
oder drei Steine trotz sorgfältigem Suchen übersehen
habe.Was noch fehlt (-->2026)
Mühlheim/Bieber
Kartendaten: Bürger-GIS des Kreises Offenbach
sowie Kultur-Landschafts-Kataster
© OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap CC-BY-SA