Die Menhire in Süd- und Mittelhessen
Ausgelöst durch die Langener Hinkelsteine beschäftigte ich mich in September und Oktober 2023 mit den Menhiren in Süd- und Mittelhessen im Rahmen von mehreren schönen Motorradtouren (deshalb auch die geografische Beschränkung). Viele der hier zusammengestellten Informationen sind im Internet erhältlich. Ich habe mich bemüht, alle relevanten Daten zusammenzufügen und auch die Standorte leichter auffindbar zu machen. Immerhin ist es mir gelungen, den jetzigen Lagerplatz des Kelkheimer Menhirs herauszufinden. Durch die Beschäftigung mit dem Thema wurde mir deutlich, dass die auf dieser Website bereits beschriebene Grabstele aus der Koberstadt ebenfalls in die Gruppe der Menhire gehört und dass deren Bedeutung bisher nicht hinreichend gewürdigt wurde.
Als mit Asterix und Obelix sozialisierter Mensch kennt man den Begriff "Hinkelstein". Aus dem Hühnenstein (von Hühnen = Riesen) wurde über den Hühnerstein der Hinkelstein (und in einem Fall ein Gluckenstein). In diesem Artikel wird der
bretonischen Begriff "Menhir" benutzt, den man mit "langer Stein" übersetzen kann. Der Begriff steht für einen länglichen, aufrechtstehenden, weitgehend unbearbeiteten Einzelstein, dessen Zweck meist unbekannt ist. Das Alter eines
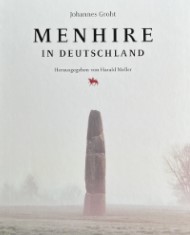 Menhirs kann nur sehr schwer festgestellt werden. Es ist auch
oftmals nicht nachvollziehbar, ob ein Stein wirklich in
prähistorischer Zeit aufgestellt wurde, z.B. als Grabstele
oder ob es sich möglicherweise um einen mittelalterlichen
Grenzstein handelt. Auf der Website https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Menhire_in_Hessen wird
daher zwischen Menhir und Monolith (sonstiger Stein mit
Menhir-Charakter) unterschieden. Manche Autoren beziehen den Ausdruck
"Menhir" ausschließlich auf eine megalithische Steinsetzung. Demnach wären
eisenzeitliche Grabstelen keine Menhire in diesem Sinne. Erst nach
Abschluss der
Recherchen hatte ich Zugang zu dem Buch von Johannes Groht "Menhire in
Deutschland" in
dem (fast) alle Menhire in Deutschland nicht nur beschrieben, sondern
auch in in stimmungsvollen Bildern exzellenter Qualität
fotografiert wurden. Ein Muss für jeden, der sich mit dem
Thema beschäftigt.
Menhirs kann nur sehr schwer festgestellt werden. Es ist auch
oftmals nicht nachvollziehbar, ob ein Stein wirklich in
prähistorischer Zeit aufgestellt wurde, z.B. als Grabstele
oder ob es sich möglicherweise um einen mittelalterlichen
Grenzstein handelt. Auf der Website https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Menhire_in_Hessen wird
daher zwischen Menhir und Monolith (sonstiger Stein mit
Menhir-Charakter) unterschieden. Manche Autoren beziehen den Ausdruck
"Menhir" ausschließlich auf eine megalithische Steinsetzung. Demnach wären
eisenzeitliche Grabstelen keine Menhire in diesem Sinne. Erst nach
Abschluss der
Recherchen hatte ich Zugang zu dem Buch von Johannes Groht "Menhire in
Deutschland" in
dem (fast) alle Menhire in Deutschland nicht nur beschrieben, sondern
auch in in stimmungsvollen Bildern exzellenter Qualität
fotografiert wurden. Ein Muss für jeden, der sich mit dem
Thema beschäftigt. Im Internet gibt es fast für jeden Stein eine spezifische Einzelseite, die mit einem Klick auf den Namen aufgerufen werden kann. Wörtliche Zitate aus dem Internet sind in blauer Schrift dargestellt. Auffallend ist, dass nur vier dieser Menhire im Denkmalverzeichnis des Landes Hessen (DenkXweb) aufgeführt sind.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass im Lagis-Flurnamenverzeichnis Südhessen der Begriff "Hinkelstein" an 22 Orten vorkommt, darunter in Dietzenbach und Erzhausen.
 Die keltische Grabstele aus der
Koberstadt
ist ein hallstattzeitlicher "langer Stein" aus dem
gleichnamigen Waldgebiet südlich von Dreieich.
Heute steht er im Palasgarten der Burg Hayn in Dreieichenhain
(-->Standort).
Es
handelt sich um einen flach-spindelförmig zugerichteten
Monolithen
aus felsigem Konglomerat des Rotliegenden mit einer Vertiefung in der
Mitte. Höhe: 175 cm; gr. Breite: 50 cm,
Tiefe: 20
cm. Er
besitzt eine interessante Geschichte: Im Jahr 1968 stolperte
Achim
Seibert aus Offenthal auf einem
Die keltische Grabstele aus der
Koberstadt
ist ein hallstattzeitlicher "langer Stein" aus dem
gleichnamigen Waldgebiet südlich von Dreieich.
Heute steht er im Palasgarten der Burg Hayn in Dreieichenhain
(-->Standort).
Es
handelt sich um einen flach-spindelförmig zugerichteten
Monolithen
aus felsigem Konglomerat des Rotliegenden mit einer Vertiefung in der
Mitte. Höhe: 175 cm; gr. Breite: 50 cm,
Tiefe: 20
cm. Er
besitzt eine interessante Geschichte: Im Jahr 1968 stolperte
Achim
Seibert aus Offenthal auf einem 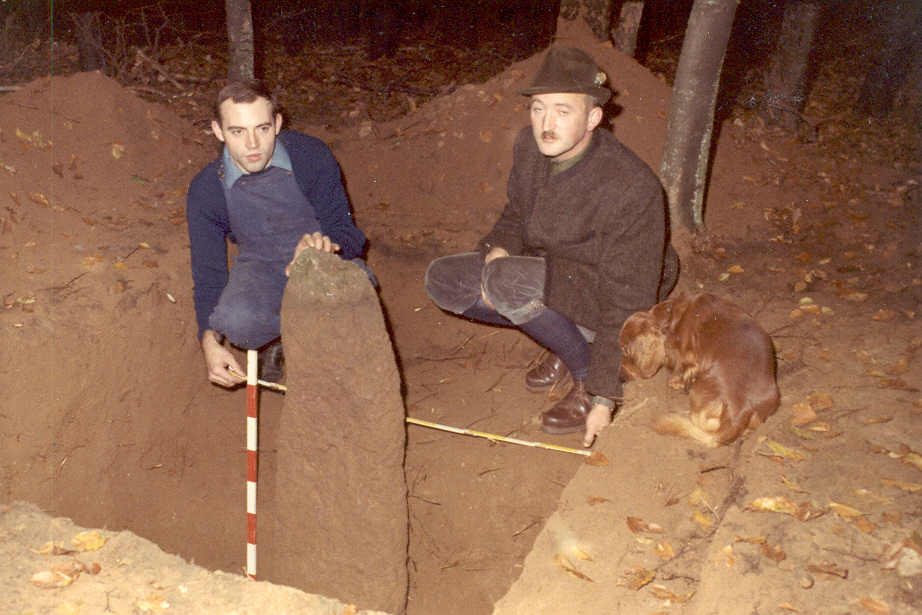 Grabhügel im
Koberstädter
Wald über einen ca. 20 cm aus dem Boden herausragenden Stein,
der
sich später als die Spitze einer Grabstele herausstellte.
Seibert
und der damalige Kreisdenkmalpfleger Ulrich sicherten den
Stein
aus Furcht vor Raubgräbern und stellten ihn vor dem
Dreieich-Museum in der Burg Hayn auf. Später wurde er in den
Palasgarten umgesetzt. Über den Fund von Seibert wurde in den "Fundberichte aus
Hessen"
9. u. 10.
Jg (1969/70), S. 159 publiziert. Der Fundort lag im Forst Koberstadt,
Waldabt. 105 (6018:79420/38085, -->Standort).
Es stellte sich heraus, dass über die Stele bereits
in den
"Quartalsblätter
des Historischen Vereins für das Großherzogtum
Hessen"
(1892), S. 154
berichtet wurde. 1891 wurde in der Koberstadt von Friedrich Kofler ein
Grabhügel erforscht. Es handelt sich um den Grabhügels
Nr. 4 auf der Karte in Lit. Nahrgang (20) S. 120. Die
Ausgräber
fanden
eine Stele mittig im Grabhügel aufrecht stehend. Am
Fuß
der
Stele fand man halbkreisförmig angeordnet Reste verschiedener
Bestattungen aus der Hallstattzeit (800 - 400 v. Chr). Die Stele wurde
wieder vergraben. Offensichtlich wurde die Spitze der Stele durch
Erosionsprozesse freigelegt und konnte somit gefunden werden. Der
Menhir aus der Koberstadt ist ein herausragendes, aber weitgehend
unbeachtetes Zeugnis der Menschen, die lange Zeit vor uns in der
Landschaft Dreieich lebten. Er verdient sicherlich eine
wertschätzendere Beachtung in der Öffentlichkeit. Kein Eintrag im DenkXweb.
Grabhügel im
Koberstädter
Wald über einen ca. 20 cm aus dem Boden herausragenden Stein,
der
sich später als die Spitze einer Grabstele herausstellte.
Seibert
und der damalige Kreisdenkmalpfleger Ulrich sicherten den
Stein
aus Furcht vor Raubgräbern und stellten ihn vor dem
Dreieich-Museum in der Burg Hayn auf. Später wurde er in den
Palasgarten umgesetzt. Über den Fund von Seibert wurde in den "Fundberichte aus
Hessen"
9. u. 10.
Jg (1969/70), S. 159 publiziert. Der Fundort lag im Forst Koberstadt,
Waldabt. 105 (6018:79420/38085, -->Standort).
Es stellte sich heraus, dass über die Stele bereits
in den
"Quartalsblätter
des Historischen Vereins für das Großherzogtum
Hessen"
(1892), S. 154
berichtet wurde. 1891 wurde in der Koberstadt von Friedrich Kofler ein
Grabhügel erforscht. Es handelt sich um den Grabhügels
Nr. 4 auf der Karte in Lit. Nahrgang (20) S. 120. Die
Ausgräber
fanden
eine Stele mittig im Grabhügel aufrecht stehend. Am
Fuß
der
Stele fand man halbkreisförmig angeordnet Reste verschiedener
Bestattungen aus der Hallstattzeit (800 - 400 v. Chr). Die Stele wurde
wieder vergraben. Offensichtlich wurde die Spitze der Stele durch
Erosionsprozesse freigelegt und konnte somit gefunden werden. Der
Menhir aus der Koberstadt ist ein herausragendes, aber weitgehend
unbeachtetes Zeugnis der Menschen, die lange Zeit vor uns in der
Landschaft Dreieich lebten. Er verdient sicherlich eine
wertschätzendere Beachtung in der Öffentlichkeit. Kein Eintrag im DenkXweb.In der sehr interessanten Publikation von Peter F. Stary "Anthropoide Stelen im früheisenzeitlichen Grabkult" (1997) wird auch über Stelen ohne figürliche Gestaltung berichtet. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob unsere Grabstele wirklich keine anthropoide Eigenschaft besitzt. Was bedeutet die Vertiefung im der Stelenmitte? Nabel? Geschlechtsorgan? Hat die Stele einen phallischen Charakter?
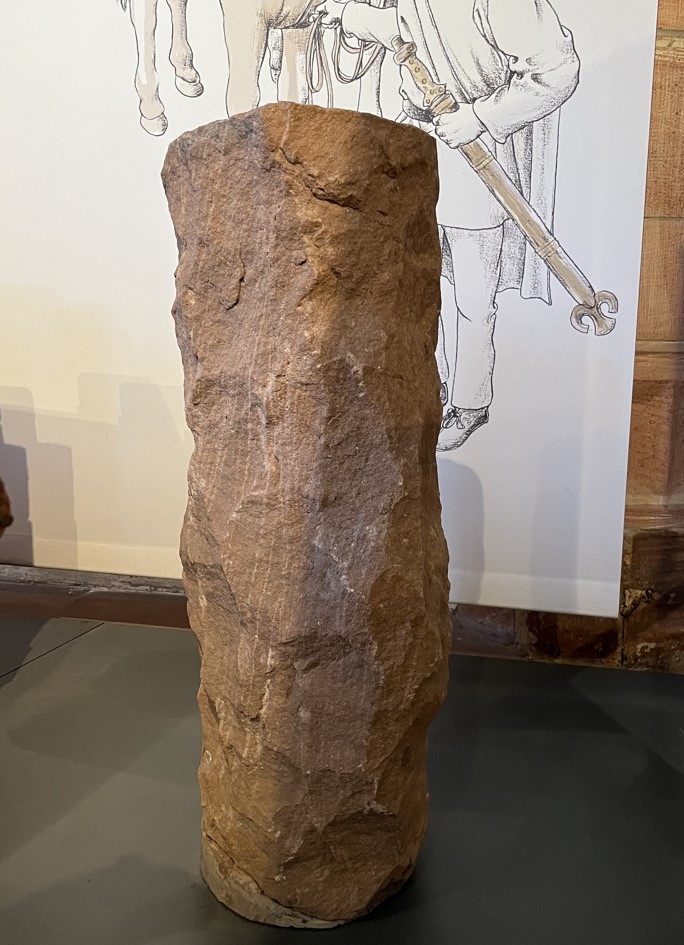 Die Stele aus dem Frankfurter Fürstengrab
findet man neben der rekonstruierten Grabliege aus der
Hallstattzeit im Archäologischen Museum in Frankfurt
(Karmelitenkloster). Es handelt sich um eine roh zugeschlagene
Säule aus rotem Sandstein, die bei Ausgrabungen im Rahmen des Baus
der A661 in den Jahren 1966/67 gefunden wurde. Die geplante
Autobahntrasse verlief über einen großen Grabhügel. In
diesem fand man neben neben der Grabstele reiche Beigaben, die man dem
Verstorbenen mit ins Grab legte. Mehr über das Fürstengrab
erfährt man bei einem lohnenswerten Besuch des Museums.
Die Stele aus dem Frankfurter Fürstengrab
findet man neben der rekonstruierten Grabliege aus der
Hallstattzeit im Archäologischen Museum in Frankfurt
(Karmelitenkloster). Es handelt sich um eine roh zugeschlagene
Säule aus rotem Sandstein, die bei Ausgrabungen im Rahmen des Baus
der A661 in den Jahren 1966/67 gefunden wurde. Die geplante
Autobahntrasse verlief über einen großen Grabhügel. In
diesem fand man neben neben der Grabstele reiche Beigaben, die man dem
Verstorbenen mit ins Grab legte. Mehr über das Fürstengrab
erfährt man bei einem lohnenswerten Besuch des Museums. Literatur: Willms, Christoph: Der Keltenfürst aus Frankfurt. Macht und Totenkult um 700 v.Chr., Archäologische Reihe 19 (Frankfurt 2002)
 Bei
den Langener
Hinkelsteinen
(-->Standort)
handelt es sich um eine
Gruppe von vier
Granit-Findlingen mit einer Höhe von 63, 68, 93 und immerhin
146
cm., über die in der heimatgeschichtlichen Literatur nichts
berichtet
ist. Es ist somit auszuschließen, dass es sich um
prähistorische
Objekte handelt. Trotz intensiven Recherchen konnten keine
Informationen über den Zeitpunkt der Aufstellung gefunden
werden. Wahrscheinlich
wurden diese vier
imposanten Steine Anfang der 1970er Jahre dort
platziert. Damals
initiierten die Stadt Langen, das Forstamt und der Langener Verkehrs-
und Verschönerungsverein den "Waldpark Langenfeld",
der aber seit einiger Zeit offensichtlich in Vergessenheit
geraten ist.
Man erreicht die Gruppe vom Parkplatz an der Brücke der
Mörfelder Straße über die B 453
in Langen/Hessen
indem man wenige Meter nach der Schranke einem Pfad nach rechts in den
Wald folgt und sich dann links hält.
Bei
den Langener
Hinkelsteinen
(-->Standort)
handelt es sich um eine
Gruppe von vier
Granit-Findlingen mit einer Höhe von 63, 68, 93 und immerhin
146
cm., über die in der heimatgeschichtlichen Literatur nichts
berichtet
ist. Es ist somit auszuschließen, dass es sich um
prähistorische
Objekte handelt. Trotz intensiven Recherchen konnten keine
Informationen über den Zeitpunkt der Aufstellung gefunden
werden. Wahrscheinlich
wurden diese vier
imposanten Steine Anfang der 1970er Jahre dort
platziert. Damals
initiierten die Stadt Langen, das Forstamt und der Langener Verkehrs-
und Verschönerungsverein den "Waldpark Langenfeld",
der aber seit einiger Zeit offensichtlich in Vergessenheit
geraten ist.
Man erreicht die Gruppe vom Parkplatz an der Brücke der
Mörfelder Straße über die B 453
in Langen/Hessen
indem man wenige Meter nach der Schranke einem Pfad nach rechts in den
Wald folgt und sich dann links hält. Die
Menhiranlage bei Roßdorf liegt eigentlich
auf
Darmstädter Gemarkungsgebiet an der Hirtenwiese am westlichen
Ufer des Ruthsenbachs. -->Standort Sie
besteht aus 6 (laut Wikipedia 14) mehr oder weniger großen
Granitsteinen (Granitporphyr),
die mindestens 1,6 Kilometer transportiert werden
mussten. Erstaunlicherweise wurde die Anlage erst 1966/1967
von
einem Roßdorfer
Heimatforscher entdeckt. Die Steine wurden damals ausgegraben und zu
einer Gruppe rekonstruiert. Die Anlage ist in DenkXweb
als Kulturdenkmal eingetragen. Man erreicht sie vom Parkplatz an der
Straße Darmstadt-Roßdorf gegenüber der
Einfahrt zum
Jugendcamp: 900 Meter nach Norden unter der B 26 durch, dann 500 Meter
rechter Hand über die Wiese und anschließend rechts
abbiegen.
Die
Menhiranlage bei Roßdorf liegt eigentlich
auf
Darmstädter Gemarkungsgebiet an der Hirtenwiese am westlichen
Ufer des Ruthsenbachs. -->Standort Sie
besteht aus 6 (laut Wikipedia 14) mehr oder weniger großen
Granitsteinen (Granitporphyr),
die mindestens 1,6 Kilometer transportiert werden
mussten. Erstaunlicherweise wurde die Anlage erst 1966/1967
von
einem Roßdorfer
Heimatforscher entdeckt. Die Steine wurden damals ausgegraben und zu
einer Gruppe rekonstruiert. Die Anlage ist in DenkXweb
als Kulturdenkmal eingetragen. Man erreicht sie vom Parkplatz an der
Straße Darmstadt-Roßdorf gegenüber der
Einfahrt zum
Jugendcamp: 900 Meter nach Norden unter der B 26 durch, dann 500 Meter
rechter Hand über die Wiese und anschließend rechts
abbiegen.  Der
Darmstädter
Hinkelstein
liegt in einer Grünanlage zusammen mit andern
Granitfindlingen an der alten Stadtmauer zwischen der Stadtbibliothek
und dem Hinkelsturm.
Er ist von der Innenstadt über die
Fußgängerbrücke Holzstraße leicht
zu erreichen. -->Standort
Leider wurde er nicht aufrecht aufgestellt. In DenkXweb
ist nachzulesen, dass er in den Küchenbereich des im Zweiten
Weltkriegs zerstörten Hauses Hinkelsgasse 15 integriert war.
Dort
kann man ein Foto aufrufen (Unterschrift: Kaplaneigasse) in der der
Stein sehr markant auf dem Bürgerstein stehend, sich an ein
Haus
lehnt. Weiterhin ist zu lesen, dass der Stein im Jahre 1912 zum Teil
weggesprengt wurde. Der Stein ist bei Groht nicht erwähnt.
Der
Darmstädter
Hinkelstein
liegt in einer Grünanlage zusammen mit andern
Granitfindlingen an der alten Stadtmauer zwischen der Stadtbibliothek
und dem Hinkelsturm.
Er ist von der Innenstadt über die
Fußgängerbrücke Holzstraße leicht
zu erreichen. -->Standort
Leider wurde er nicht aufrecht aufgestellt. In DenkXweb
ist nachzulesen, dass er in den Küchenbereich des im Zweiten
Weltkriegs zerstörten Hauses Hinkelsgasse 15 integriert war.
Dort
kann man ein Foto aufrufen (Unterschrift: Kaplaneigasse) in der der
Stein sehr markant auf dem Bürgerstein stehend, sich an ein
Haus
lehnt. Weiterhin ist zu lesen, dass der Stein im Jahre 1912 zum Teil
weggesprengt wurde. Der Stein ist bei Groht nicht erwähnt. Der Alsbacher
Hinkelstein steht am Westrand von Alsbach in der
Nähe der Straßenbahnendhaltestelle in einer kleinen
Anlage mit Sitzbänken -->Standort.
Er
besteht aus Malachit, einem seltenen plutonischen Ganggestein, das
durch Vulkanismus entstand. Der Menhir stammt aus einem
Steinbruch
am Luciberg unterhalb des Melibokus bei Zwingenberg. Circa 2000 Jahre
v. Chr. wurde der Hinkelstein an den etwa zwei Kilometer entfernten
Aufstellungsort am Westrand von Alsbach verbracht. Der Hinkelstein hat
ein Gewicht von ca. 3,35 Tonnen. Er ragt etwas mehr als eineinhalb
Meter aus dem Boden, ist gut einen Meter breit und knapp einen halben
Meter dick. Im Jahre 1812 wurden Grabungen unter dem Hinkelstein
gemacht; dabei wurde der Untergrund so instabil, dass der Stein umfiel.
Anschließend eingegraben wurde er 1866 vom Historischen
Verein
für Hessen aus dem Erdreich geholt und wieder an der
ursprünglichen Stelle aufgestellt. Man erreicht
den
Hinkelstein vom Parkplatz der Straßenbahnhaltestelle "Am
Hinkelstein", indem man ca. 250 Meter dem Weg östlich der
Schienen
folgt. Der Hinkelstein ist in Alsbach seht präsent: Neben der
Straßenbahnhaltestelle gibt es eine "Schule am
Hinkelstein",
eine "Hinkelsteinhalle" und eine Straße "Am Hinkelstein".
Mehr
dazu steht in einem Artikel
des Darmstädter Echos. Kein Eintrag im DenkXweb.
Der Alsbacher
Hinkelstein steht am Westrand von Alsbach in der
Nähe der Straßenbahnendhaltestelle in einer kleinen
Anlage mit Sitzbänken -->Standort.
Er
besteht aus Malachit, einem seltenen plutonischen Ganggestein, das
durch Vulkanismus entstand. Der Menhir stammt aus einem
Steinbruch
am Luciberg unterhalb des Melibokus bei Zwingenberg. Circa 2000 Jahre
v. Chr. wurde der Hinkelstein an den etwa zwei Kilometer entfernten
Aufstellungsort am Westrand von Alsbach verbracht. Der Hinkelstein hat
ein Gewicht von ca. 3,35 Tonnen. Er ragt etwas mehr als eineinhalb
Meter aus dem Boden, ist gut einen Meter breit und knapp einen halben
Meter dick. Im Jahre 1812 wurden Grabungen unter dem Hinkelstein
gemacht; dabei wurde der Untergrund so instabil, dass der Stein umfiel.
Anschließend eingegraben wurde er 1866 vom Historischen
Verein
für Hessen aus dem Erdreich geholt und wieder an der
ursprünglichen Stelle aufgestellt. Man erreicht
den
Hinkelstein vom Parkplatz der Straßenbahnhaltestelle "Am
Hinkelstein", indem man ca. 250 Meter dem Weg östlich der
Schienen
folgt. Der Hinkelstein ist in Alsbach seht präsent: Neben der
Straßenbahnhaltestelle gibt es eine "Schule am
Hinkelstein",
eine "Hinkelsteinhalle" und eine Straße "Am Hinkelstein".
Mehr
dazu steht in einem Artikel
des Darmstädter Echos. Kein Eintrag im DenkXweb.  Der Menhir
von Bensheim
steht in einer kleinen Anlage an der Kreuzung
Röderweg mit
Den Straßen Auf der Schnell/Am Hinkelstein (Navi: Am
Hinkelstein
1) -->Standort.
Der
Menhir besteht aus Granit. Er läuft in einer rundlichen
Spitze
aus und weist an seiner südlichen und östlichen Seite
künstliche Bearbeitungsspuren auf. Der Stein hat eine
Höhe
von 140 cm, eine Breite von 90 cm und eine Dicke von 60 cm.
Der Menhir
von Bensheim
steht in einer kleinen Anlage an der Kreuzung
Röderweg mit
Den Straßen Auf der Schnell/Am Hinkelstein (Navi: Am
Hinkelstein
1) -->Standort.
Der
Menhir besteht aus Granit. Er läuft in einer rundlichen
Spitze
aus und weist an seiner südlichen und östlichen Seite
künstliche Bearbeitungsspuren auf. Der Stein hat eine
Höhe
von 140 cm, eine Breite von 90 cm und eine Dicke von 60 cm. Groht merkt noch an, dass der Stein an der Grenze von Chur-Mainz und Erbach steht. Ansonsten ist die Information über diesen Stein recht dünn. Kein Eintrag im DenkXweb.

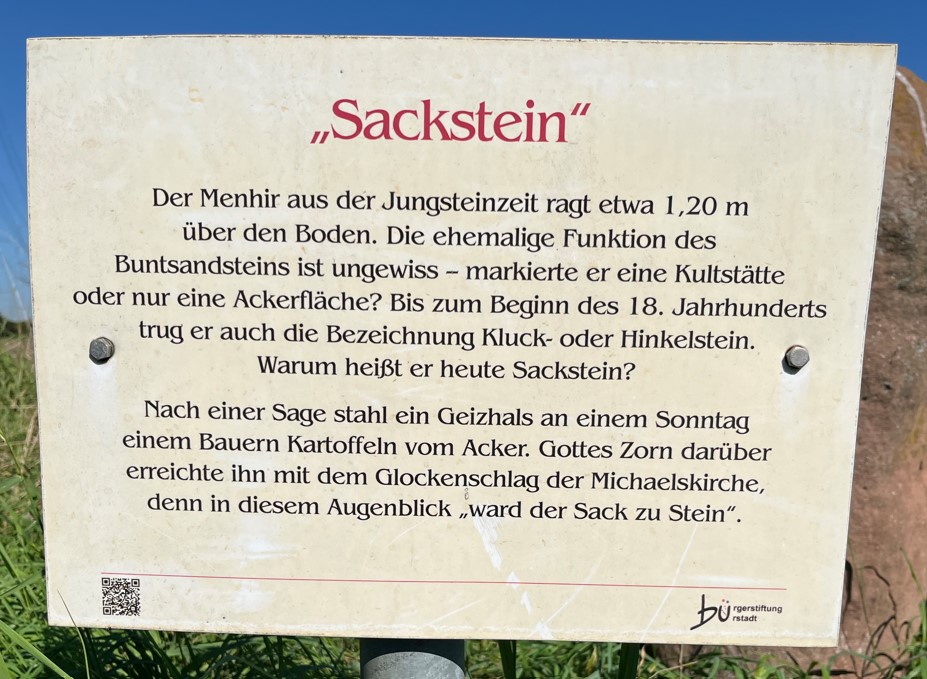 Der Sackstein
von Bürstadt befindet sich im freien Feld in der
Nähe einer Bahnlinie nordwestlich von Bürstadt -->Standort.
Der
Menhir besteht aus rotem Sandstein. Er hat eine Höhe von 115
cm,
eine Breite von 45 cm und eine Tiefe von 47 cm. Er ist
säulenförmig und besitzt eine
unregelmäßige
Oberfläche. Mögliche Bearbeitungsspuren sind
mittlerweile
stark verwittert.
Der Sackstein
von Bürstadt befindet sich im freien Feld in der
Nähe einer Bahnlinie nordwestlich von Bürstadt -->Standort.
Der
Menhir besteht aus rotem Sandstein. Er hat eine Höhe von 115
cm,
eine Breite von 45 cm und eine Tiefe von 47 cm. Er ist
säulenförmig und besitzt eine
unregelmäßige
Oberfläche. Mögliche Bearbeitungsspuren sind
mittlerweile
stark verwittert.Die Bezeichnung Sackstein geht auf eine Sage zurück: Demnach wollte ein Bauer einst an einem Sonntagmorgen einen Sack Kartoffeln füllen. Genau in dem Moment, als er seine Arbeit beendet hatte, fingen die Kirchenglocken an zu läuten. Da wurde der Sack plötzlich so schwer, dass der Bauer ihn nicht mehr heben konnte, denn er war zu Stein geworden.
Man erreicht den Stein von der B44 Ausfahrt Richtung Bobstadt. Nach dem Kreisel links abbiegen zur Kläranlage (oder Navi: Kläranlage Bürstadt). Von dort aus sind es noch 700 Meter Gerader Weg Richtung Eisenbahnlinie. Kein Eintrag im DenkXweb.
 Der
Menhir
von Wersau wurde
1977 bei Feldarbeiten entdeckt und etwa 70 m von seinem Fundort
entfernt, auf der Kreisgrenze zwischen Odenwaldkreis und Landkreis
Darmstadt-Dieburg wieder aufgerichtet -->Standort.
Der Menhir besteht aus bergsträßer Diorit; das
Gestein
stammt vom nahe gelegenen Bensenböhlskopf. Der Stein ist
plattenförmig und leicht geschwungen. Sein oberirdisch
sichtbarer
Teil hat eine Höhe von 180 cm, eine Breite von 120 cm und eine
Dicke von 40 cm. Seine Gesamthöhe beträgt 295 cm; die
breiteste Stelle liegt unterirdisch und misst 150 cm (Wikipedia).
Er
soll auch zur Bestimmung des Datums der Tag- und Nachtgleiche
benutzt worden sein. Man erreicht ihn von (Navi) Wersau,
Bahnhofstraße 48 aus, indem man dem Alten Weg (Fortsetzung
der
Bahnhofstraße) 600 Meter nach Nordwesten folgt und dann in
einen
Wiesenweg nach links biegt. Am Waldrand weist ein Schild auf die Alte
Landwehr hin. Nach weiteren 130 Meter den Waldrand entlang erreicht man
den Menhir. Kein Eintrag im DenkXweb.
Der
Menhir
von Wersau wurde
1977 bei Feldarbeiten entdeckt und etwa 70 m von seinem Fundort
entfernt, auf der Kreisgrenze zwischen Odenwaldkreis und Landkreis
Darmstadt-Dieburg wieder aufgerichtet -->Standort.
Der Menhir besteht aus bergsträßer Diorit; das
Gestein
stammt vom nahe gelegenen Bensenböhlskopf. Der Stein ist
plattenförmig und leicht geschwungen. Sein oberirdisch
sichtbarer
Teil hat eine Höhe von 180 cm, eine Breite von 120 cm und eine
Dicke von 40 cm. Seine Gesamthöhe beträgt 295 cm; die
breiteste Stelle liegt unterirdisch und misst 150 cm (Wikipedia).
Er
soll auch zur Bestimmung des Datums der Tag- und Nachtgleiche
benutzt worden sein. Man erreicht ihn von (Navi) Wersau,
Bahnhofstraße 48 aus, indem man dem Alten Weg (Fortsetzung
der
Bahnhofstraße) 600 Meter nach Nordwesten folgt und dann in
einen
Wiesenweg nach links biegt. Am Waldrand weist ein Schild auf die Alte
Landwehr hin. Nach weiteren 130 Meter den Waldrand entlang erreicht man
den Menhir. Kein Eintrag im DenkXweb. Der Monolith
von Klein-Umstadt
wurde 1977 südwestlich des heutigen Standortes
entdeckt und
seltsamerweise hinter einer Pumpstation relativ unzugänglich
wieder aufgestellt. -->Standort.
Der
Menhir besteht aus Odenwälder Sandstein (Rotsandstein). Er hat
einen annähernd rechteckigen Querschnitt (Drachenviereck) und
verjüngt sich auf allen Seiten nach oben hin. Der Stein hat
eine
Gesamthöhe von 133 cm, davon entfallen 102 cm auf den
oberirdisch
sichtbaren Teil. Seine Breite beträgt 59 cm und seine Dicke 50
cm.
Es ist nicht klar, ob es sich um einen vorgeschichtlichen Menhir oder
um einen Grenzstein handelt. Man erreicht ihn
vom
Bahnübergang in Klein-Umstadt (Navi:
Bahnhofstraße 109)
aus den man passiert und der Bahnlinie 270 Meter nach
Nordosten
folgt. Dann biegt man nach links ab und erreicht nach knapp 900 Meter
die Wasserstation, auf deren Rückseite der Stein zu finden ist.
Der Monolith
von Klein-Umstadt
wurde 1977 südwestlich des heutigen Standortes
entdeckt und
seltsamerweise hinter einer Pumpstation relativ unzugänglich
wieder aufgestellt. -->Standort.
Der
Menhir besteht aus Odenwälder Sandstein (Rotsandstein). Er hat
einen annähernd rechteckigen Querschnitt (Drachenviereck) und
verjüngt sich auf allen Seiten nach oben hin. Der Stein hat
eine
Gesamthöhe von 133 cm, davon entfallen 102 cm auf den
oberirdisch
sichtbaren Teil. Seine Breite beträgt 59 cm und seine Dicke 50
cm.
Es ist nicht klar, ob es sich um einen vorgeschichtlichen Menhir oder
um einen Grenzstein handelt. Man erreicht ihn
vom
Bahnübergang in Klein-Umstadt (Navi:
Bahnhofstraße 109)
aus den man passiert und der Bahnlinie 270 Meter nach
Nordosten
folgt. Dann biegt man nach links ab und erreicht nach knapp 900 Meter
die Wasserstation, auf deren Rückseite der Stein zu finden ist. Der
Hohestein
von Kelkheim wurde laut Wikipedia erstmals
1714 erwähnt. Er stand zunächst zwischen Kelkheim und
Fischbach auf dem Hühnerberg, nahe dem Flurstück Am
Hohenstein. Er diente damals dort als
Grenzstein zwischen beiden Gemarkungen. In Fischbach gibt es sowohl
eine Straße "Am Hohenstein" als auch eine "Am
Hühnerberg". Weiter mit Wikipedia: Später
wurde er bei Vermessungsarbeiten umgesetzt und befindet sich heute
nicht weit von seinem vorherigen Standort in einem Obstgarten neben
einem Schuppen (-->Standortangabe)
In dem Eintrag wurden auch Koordinaten des Standortes angegeben, ein
Grund für eine Motorradtour im Sommer 2023 nach Fischbach. Der angegebene
Punkt
lag in einer dichten Hecke. Trotz intensiven Suchens war kein
Hinkelstein am Hinkelsberg zu finden. Ein ehemaliger Studienkollege,
der Kelkheimer Stadtverordnete Dr. Zellhofer, erkundigte sich beim
Stadtarchivar Wirth und erhielt die Auskunft, dass der Stein von dieser
Stelle aus Sicherheitsgründen zum Kelkheimer Bauhof
verbracht
wurde. Dieser war dann Ziel einer weiteren Motorradtour. Der
Stein
lag auf einer Palette im Hochregallager. Er ist insgesamt 141 cm lang,
davon die untere Verdickung 40 cm. Die Breite beträgt
ca. 25
cm, die Tiefe ca. 12 cm. Beide Zahlen sind etwas kleiner als die
Angaben in Wikipedia. Dort wird das Material
als grünlicher
Quarzit bezeichnet. Möglicherweise handelt
es sich eher
um Serizit-Gneis, der heute noch in Fischbach in einem Steinbruch
gewonnen wird. Bei Grote ist der Stein auf seinem alten
Standort abgebildet.
Der
Hohestein
von Kelkheim wurde laut Wikipedia erstmals
1714 erwähnt. Er stand zunächst zwischen Kelkheim und
Fischbach auf dem Hühnerberg, nahe dem Flurstück Am
Hohenstein. Er diente damals dort als
Grenzstein zwischen beiden Gemarkungen. In Fischbach gibt es sowohl
eine Straße "Am Hohenstein" als auch eine "Am
Hühnerberg". Weiter mit Wikipedia: Später
wurde er bei Vermessungsarbeiten umgesetzt und befindet sich heute
nicht weit von seinem vorherigen Standort in einem Obstgarten neben
einem Schuppen (-->Standortangabe)
In dem Eintrag wurden auch Koordinaten des Standortes angegeben, ein
Grund für eine Motorradtour im Sommer 2023 nach Fischbach. Der angegebene
Punkt
lag in einer dichten Hecke. Trotz intensiven Suchens war kein
Hinkelstein am Hinkelsberg zu finden. Ein ehemaliger Studienkollege,
der Kelkheimer Stadtverordnete Dr. Zellhofer, erkundigte sich beim
Stadtarchivar Wirth und erhielt die Auskunft, dass der Stein von dieser
Stelle aus Sicherheitsgründen zum Kelkheimer Bauhof
verbracht
wurde. Dieser war dann Ziel einer weiteren Motorradtour. Der
Stein
lag auf einer Palette im Hochregallager. Er ist insgesamt 141 cm lang,
davon die untere Verdickung 40 cm. Die Breite beträgt
ca. 25
cm, die Tiefe ca. 12 cm. Beide Zahlen sind etwas kleiner als die
Angaben in Wikipedia. Dort wird das Material
als grünlicher
Quarzit bezeichnet. Möglicherweise handelt
es sich eher
um Serizit-Gneis, der heute noch in Fischbach in einem Steinbruch
gewonnen wird. Bei Grote ist der Stein auf seinem alten
Standort abgebildet.  Am 19.5.2024 wurde der Stein im Kelkheimer Stadtmuseum im Rahmen eines
Vortrags von Frau Dr. Kristin Funke der Öffentlichkeit
vorgestellt. Sie wies darauf hin, dass seine Funktion als ehemaliger
Grenzstein nachgewiesen ist. Bei einer Nachgrabung an dem ehemaligen
Standort fand man Tonscherben, die als Zeugen unter dem Stein lagen
sowie steinzeitliche Pfeilspitzen im Füllmaterial (!). Aus diesem
Befund und der Tatsache, dass der Hünerberg in der Jungsteinzeit
besiedelt war, schloss sie auf einen megalithischen Ursprung (ca. 5000 v.Chr.).
Am 19.5.2024 wurde der Stein im Kelkheimer Stadtmuseum im Rahmen eines
Vortrags von Frau Dr. Kristin Funke der Öffentlichkeit
vorgestellt. Sie wies darauf hin, dass seine Funktion als ehemaliger
Grenzstein nachgewiesen ist. Bei einer Nachgrabung an dem ehemaligen
Standort fand man Tonscherben, die als Zeugen unter dem Stein lagen
sowie steinzeitliche Pfeilspitzen im Füllmaterial (!). Aus diesem
Befund und der Tatsache, dass der Hünerberg in der Jungsteinzeit
besiedelt war, schloss sie auf einen megalithischen Ursprung (ca. 5000 v.Chr.). Dies ist eine schöne Hypothese, die sich wahrscheinlich nicht endgültig beweisen lässt. Aber: Für einen megalitheischen Menhir besitzt der Stein nicht die für einen Menhir typische Gestalt. Er ist m.E. zu klein und zu schmal. Diese Zerbechlichkeit ist m.E. auch der Grund, dass der Stein nicht als Grenzstein konzipiert worden ist. Ein Argument gegen die Megalith-Hypothese brachte der ehemalige Stadtarchivar Dietrich Kleipa in einem interessanten Diskussionsbeitrag vor: Die Oberfläche des Steins sieht nicht so aus, als dass sie 7000 Jahre der Witterung ausgesetzt wäre.
Für mich ist die These wahrscheinlicher, dass es sich eher um eine eisenzeitliche Grabstele handelt. Auf dem Hühnerberg gab es neben einer jungsteinzeitlichen Siedlung (FAZ vom 15.05.2024) auch Zeichen einer Besiedlung in der frühen Latenezeit (um 500 v. Chr.). S. dazu auch die Ausarbeitung von Sturm-Berger. Kein Eintrag im DenkXweb.
 Der
Gluckenstein
in Bad Homburg steht mitten auf dem Bürgersteig am
Gluckensteinweg 99 (Navi) im Stadtteil Kirdorf an der Gesamtschule Am
Gluckenstein. -->Standort
. Es soll sich um einen ehemaligen Grenzstein zwischen den Gemarkungen Kirdorf und
Homburg gehandelt haben. Wikipedia: Der Stein mit einem
Gewicht von etwa zwölf Zentnern befand sich Anfang
des 20. Jahrhunderts noch auf dem freien Feld
Der
Gluckenstein
in Bad Homburg steht mitten auf dem Bürgersteig am
Gluckensteinweg 99 (Navi) im Stadtteil Kirdorf an der Gesamtschule Am
Gluckenstein. -->Standort
. Es soll sich um einen ehemaligen Grenzstein zwischen den Gemarkungen Kirdorf und
Homburg gehandelt haben. Wikipedia: Der Stein mit einem
Gewicht von etwa zwölf Zentnern befand sich Anfang
des 20. Jahrhunderts noch auf dem freien Feld  und ragte zwei Meter in
die Höhe. Eine erste urkundliche Erwähnung als
Grenzstein zwischen
Kirdorf und Homburg stammt aus dem Jahr 1536. Im Laufe des 20.
Jahrhunderts wuchsen Bad Homburg und Kirdorf immer weiter aufeinander
zu und verschmolzen letztlich. Durch Aufschüttungen im Rahmen
der
jeweiligen Baumaßnahmen wurde der Stein immer weiter
zugeschüttet und ragte 1954 nur noch 1,45 Meter und 1965 nur
noch
1,15 Meter hoch aus der Erde. Heute liegt der Stein inmitten der
Bebauung.
und ragte zwei Meter in
die Höhe. Eine erste urkundliche Erwähnung als
Grenzstein zwischen
Kirdorf und Homburg stammt aus dem Jahr 1536. Im Laufe des 20.
Jahrhunderts wuchsen Bad Homburg und Kirdorf immer weiter aufeinander
zu und verschmolzen letztlich. Durch Aufschüttungen im Rahmen
der
jeweiligen Baumaßnahmen wurde der Stein immer weiter
zugeschüttet und ragte 1954 nur noch 1,45 Meter und 1965 nur
noch
1,15 Meter hoch aus der Erde. Heute liegt der Stein inmitten der
Bebauung.Ob es sich tatsächlich um einen prähistorischen Menhir handelt, ist unklar. Im Gebiet des Vordertaunus gibt es Funde der Megalithkultur. Der Form nach könnte es sich um einen Menhir handeln. Spuren einer Bearbeitung finden sich jedoch nicht. Ebenso ist aber auch denkbar, dass es sich um einen Findling handelt. Der Gluckenstein ist in DenkXweb eingetragen: Der Bannstein, ehemals auch "Scherer" genannt (1536) zählt zu den ältesten bekannten Hoheitszeichen in Hessen.
 Der Menhir
von Ober-Mörlen erreicht
man von der Kapelle am nordöstlichen Ortseingang der B 275,
indem
man dem Kehlweg (Navi) 1,5 km folgt und dann in den Weg "Am
Menhir"
nach links einbiegt. Er steht nach weiteren 700 Metern in einem kleinen
Hain. -->Standort Wikipedia:
Der
Menhir besteht aus Brekzie, die vor allem aus Milchquarz, Kappenquarzen
und Schiefergeröllen zusammengesetzt ist; das Material stammt
vom
nahe gelegenen Galgenberg. Der Stein ist plattenförmig und
oben
abgerundet. Er hat eine Höhe von 250 cm, eine Breite von 200
cm
und eine Tiefe von 110 cm. Er ist in DenkXweb
verzeichnet. Danach wurde er 1975 bei
Flurbereinigungsmaßnahmen im Erdreich gefunden und daraufhin
750 Meter westlich des Fundortes
aufgestellt.
Der Menhir
von Ober-Mörlen erreicht
man von der Kapelle am nordöstlichen Ortseingang der B 275,
indem
man dem Kehlweg (Navi) 1,5 km folgt und dann in den Weg "Am
Menhir"
nach links einbiegt. Er steht nach weiteren 700 Metern in einem kleinen
Hain. -->Standort Wikipedia:
Der
Menhir besteht aus Brekzie, die vor allem aus Milchquarz, Kappenquarzen
und Schiefergeröllen zusammengesetzt ist; das Material stammt
vom
nahe gelegenen Galgenberg. Der Stein ist plattenförmig und
oben
abgerundet. Er hat eine Höhe von 250 cm, eine Breite von 200
cm
und eine Tiefe von 110 cm. Er ist in DenkXweb
verzeichnet. Danach wurde er 1975 bei
Flurbereinigungsmaßnahmen im Erdreich gefunden und daraufhin
750 Meter westlich des Fundortes
aufgestellt.  Der
Menhir vom Butzbach wurde 1978 entdeckt
und auf der westlichen Seite der B3 neu aufgestellt. -->Standort
Man erreicht ihn, wenn man sein Fahrzeug im
Bereich der Alten Wetzlarer Straße 47
(Navi) abstellt und von der Kreuzung mit
der B3
dem Fahrradweg in nördlicher Richtung folgt, bis man die
Leitplanken erreicht. Der Stein steht dann auf der anderen
Straßenseite unterhalb des Lidl-Logos im Gebüsch.
Wikipedia: Der
Menhir besteht aus
Taunus-Quarzit. Er ist plattenförmig und verjüngt
sich nach
oben. Der Stein hat eine Gesamthöhe von 272 cm, eine Breite
von
125 cm und eine Tiefe von 80 cm. Die dickste und breiteste Stelle
befindet sich unter der Erde. Der oberirdisch sichtbare Teil hat eine
Höhe von 170 cm, eine Breite von 120 cm un eine Tiefe von 70
cm. Ich versuche, noch weitere Informationen über
diesen Stein zu erhalten. Kein Eintrag im DenkXweb.
Der
Menhir vom Butzbach wurde 1978 entdeckt
und auf der westlichen Seite der B3 neu aufgestellt. -->Standort
Man erreicht ihn, wenn man sein Fahrzeug im
Bereich der Alten Wetzlarer Straße 47
(Navi) abstellt und von der Kreuzung mit
der B3
dem Fahrradweg in nördlicher Richtung folgt, bis man die
Leitplanken erreicht. Der Stein steht dann auf der anderen
Straßenseite unterhalb des Lidl-Logos im Gebüsch.
Wikipedia: Der
Menhir besteht aus
Taunus-Quarzit. Er ist plattenförmig und verjüngt
sich nach
oben. Der Stein hat eine Gesamthöhe von 272 cm, eine Breite
von
125 cm und eine Tiefe von 80 cm. Die dickste und breiteste Stelle
befindet sich unter der Erde. Der oberirdisch sichtbare Teil hat eine
Höhe von 170 cm, eine Breite von 120 cm un eine Tiefe von 70
cm. Ich versuche, noch weitere Informationen über
diesen Stein zu erhalten. Kein Eintrag im DenkXweb.  Der Kräppelstein
vom Münzenberg befindet sich in einer
kleinen Anlage an der
östlichen
Brückenrampe (Wetterstraße) der K166 über
die A 45. Die
K166 ist die Verbindungsstraße von Münzenberg nach
Trais
Münzenberg -->Standort.
Wikipedia: Der
Menhir besteht aus Konglomeratgestein vom nahe gelegenen Steinberg; der
Menhir bei Muschenheim besteht aus dem gleichen Material. Der
Kräppelstein ist unregelmäßig geformt und
läuft
leicht spitz zu. Er hat eine Gesamthöhe von 330 cm (davon 240
cm
oberirdisch), eine Breite von 160 cm und eine Tiefe von 120 cm. Der
Stein lag ursprünglich halb vergraben und wurde 1978 in der
Nähe seines ursprünglichen Standorts wieder
aufgerichtet.[1]
Auf seiner Oberfläche sind mehrere kleine Löcher
erkennbar. Kein Eintrag im DenkXweb.
Der Kräppelstein
vom Münzenberg befindet sich in einer
kleinen Anlage an der
östlichen
Brückenrampe (Wetterstraße) der K166 über
die A 45. Die
K166 ist die Verbindungsstraße von Münzenberg nach
Trais
Münzenberg -->Standort.
Wikipedia: Der
Menhir besteht aus Konglomeratgestein vom nahe gelegenen Steinberg; der
Menhir bei Muschenheim besteht aus dem gleichen Material. Der
Kräppelstein ist unregelmäßig geformt und
läuft
leicht spitz zu. Er hat eine Gesamthöhe von 330 cm (davon 240
cm
oberirdisch), eine Breite von 160 cm und eine Tiefe von 120 cm. Der
Stein lag ursprünglich halb vergraben und wurde 1978 in der
Nähe seines ursprünglichen Standorts wieder
aufgerichtet.[1]
Auf seiner Oberfläche sind mehrere kleine Löcher
erkennbar. Kein Eintrag im DenkXweb.  Das Megalith-Grab
Heiliger Stein bei Muschenheim
(Ortsteil von Lich) erreicht man am besten von der
Hessengasse
39 in Muschenheim (Navi) aus. Man folgt dem Weg an
Aussiedlerhöfen
vorbei.
Nach 1300 Meter biegt man nach rechts bergauf (-->Standort)
Die jungsteinzeitliche Megalithanlage wurde bereits 1893 von
Friedrich Kofler ausgegraben 1913 erneut untersucht und zwischen 1989
und 2003 restauriert wurde. Die Anlage besteht aus einer 80 cm hohen
Grabkammer, die von drei großen 6-7 Tonnen schweren
Steinen
überdeckt und über einen Gang von Norden
zugänglich ist. Neben dem Eingangsbereich steht ein
großer
2,75 Meter aus dem Boden ragender Menhir. Seltsamerweise
ist das Megalith-Grab nicht als Kulturdenkmal gelistet. In
einem Artikel
vom Manfred Menke
wird die archäologischen Ausgrabungen und Befunde
ausführlich beschrieben. Auch die drei Tafeln am Grab geben
interessante Einblicke.
Das Megalith-Grab
Heiliger Stein bei Muschenheim
(Ortsteil von Lich) erreicht man am besten von der
Hessengasse
39 in Muschenheim (Navi) aus. Man folgt dem Weg an
Aussiedlerhöfen
vorbei.
Nach 1300 Meter biegt man nach rechts bergauf (-->Standort)
Die jungsteinzeitliche Megalithanlage wurde bereits 1893 von
Friedrich Kofler ausgegraben 1913 erneut untersucht und zwischen 1989
und 2003 restauriert wurde. Die Anlage besteht aus einer 80 cm hohen
Grabkammer, die von drei großen 6-7 Tonnen schweren
Steinen
überdeckt und über einen Gang von Norden
zugänglich ist. Neben dem Eingangsbereich steht ein
großer
2,75 Meter aus dem Boden ragender Menhir. Seltsamerweise
ist das Megalith-Grab nicht als Kulturdenkmal gelistet. In
einem Artikel
vom Manfred Menke
wird die archäologischen Ausgrabungen und Befunde
ausführlich beschrieben. Auch die drei Tafeln am Grab geben
interessante Einblicke. 
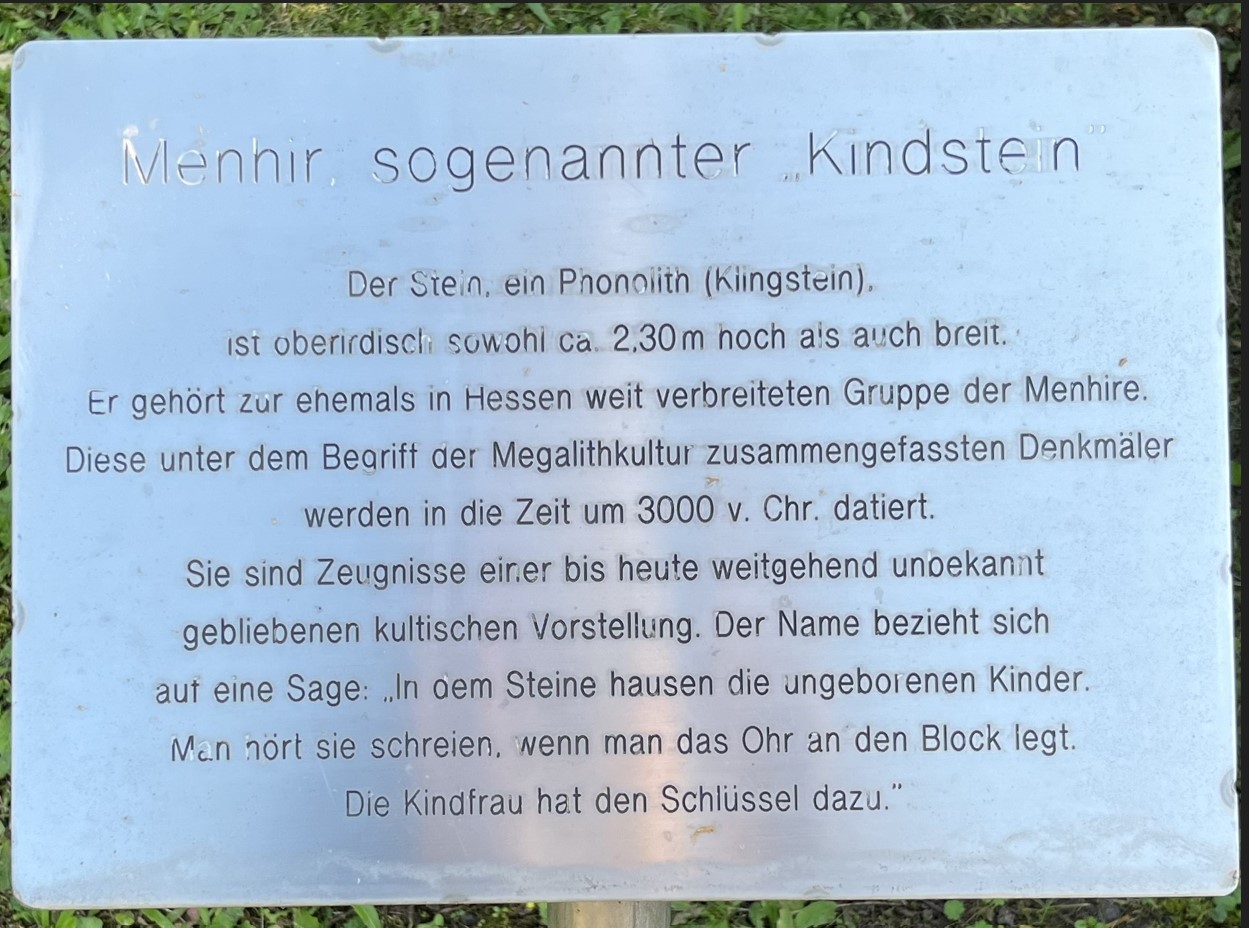 Der Kindstein von
Unter-Widdersheim (Ortsteil von Nidda) steht in einer kleinen
Anlage an der Straße "Zum Kindstein", Navi: Nr. 4, -->Standort.
In Wikipedia ist zu lesen: Der
Menhir besteht aus Phonolith; das nächste Vorkommen dieses
Gesteins liegt in einer Entfernung von etwa 5–6 km. Er hat
einen
annähernd ovalen Querschnitt, verjüngt sich nach oben
hin und
läuft in einer markanten Spitze aus. Der Stein hat eine
Höhe
von 255 cm, eine Breite von 230 cm und eine Tiefe von 100 cm.
Der
Name des Steins geht auf eine Sage zurück. Laut dieser sollen
in
ihm ungeborene Kinder hausen, deren Schreie man hören kann,
wenn
man das Ohr an den Stein hält. -->
Hier ist ein Artikel von Friedrich Kofler aus dem Jahr 1886
über den Kindstein aufzurufen. Einer anderen Beschreibung
ist zu entnehmen, dass er auf seinem Originalstandplatz steht. Kein Eintrag im DenkXweb.
Der Kindstein von
Unter-Widdersheim (Ortsteil von Nidda) steht in einer kleinen
Anlage an der Straße "Zum Kindstein", Navi: Nr. 4, -->Standort.
In Wikipedia ist zu lesen: Der
Menhir besteht aus Phonolith; das nächste Vorkommen dieses
Gesteins liegt in einer Entfernung von etwa 5–6 km. Er hat
einen
annähernd ovalen Querschnitt, verjüngt sich nach oben
hin und
läuft in einer markanten Spitze aus. Der Stein hat eine
Höhe
von 255 cm, eine Breite von 230 cm und eine Tiefe von 100 cm.
Der
Name des Steins geht auf eine Sage zurück. Laut dieser sollen
in
ihm ungeborene Kinder hausen, deren Schreie man hören kann,
wenn
man das Ohr an den Stein hält. -->
Hier ist ein Artikel von Friedrich Kofler aus dem Jahr 1886
über den Kindstein aufzurufen. Einer anderen Beschreibung
ist zu entnehmen, dass er auf seinem Originalstandplatz steht. Kein Eintrag im DenkXweb. 
 Die Ulfaer Hinkelsteine sind etwas Besonderes: Das Haus
Steinstraße 5 in Ulfa -->Standort ist
im DenkXweb als Kulturdenkmal eingetragen. Im Text ist zu
lesen: "Über Basaltsockel mit interessantem
Radabweiser (roh
behauener, großer Stein, vielleicht ein Menhir)". Mer waases
net. Aber die Ulfaaner haben sich vor das Schützenhaus einen
neuen
Hinkelstein aufgestellt (-->Standort).
Auf dem Metallschild ist zu lesen, dass der anscheinend verschwundene 5
Fuß hohe Ulfaer Hinkelstein an dem Weg nach
Stornfels stand.
Zur Erinnerung an diesen Stein wurde vom Heimat-
und Geschichtsverein im Jahr 2021 ein neuer
Hinkelstein aufgestellt.
Die Ulfaer Hinkelsteine sind etwas Besonderes: Das Haus
Steinstraße 5 in Ulfa -->Standort ist
im DenkXweb als Kulturdenkmal eingetragen. Im Text ist zu
lesen: "Über Basaltsockel mit interessantem
Radabweiser (roh
behauener, großer Stein, vielleicht ein Menhir)". Mer waases
net. Aber die Ulfaaner haben sich vor das Schützenhaus einen
neuen
Hinkelstein aufgestellt (-->Standort).
Auf dem Metallschild ist zu lesen, dass der anscheinend verschwundene 5
Fuß hohe Ulfaer Hinkelstein an dem Weg nach
Stornfels stand.
Zur Erinnerung an diesen Stein wurde vom Heimat-
und Geschichtsverein im Jahr 2021 ein neuer
Hinkelstein aufgestellt. 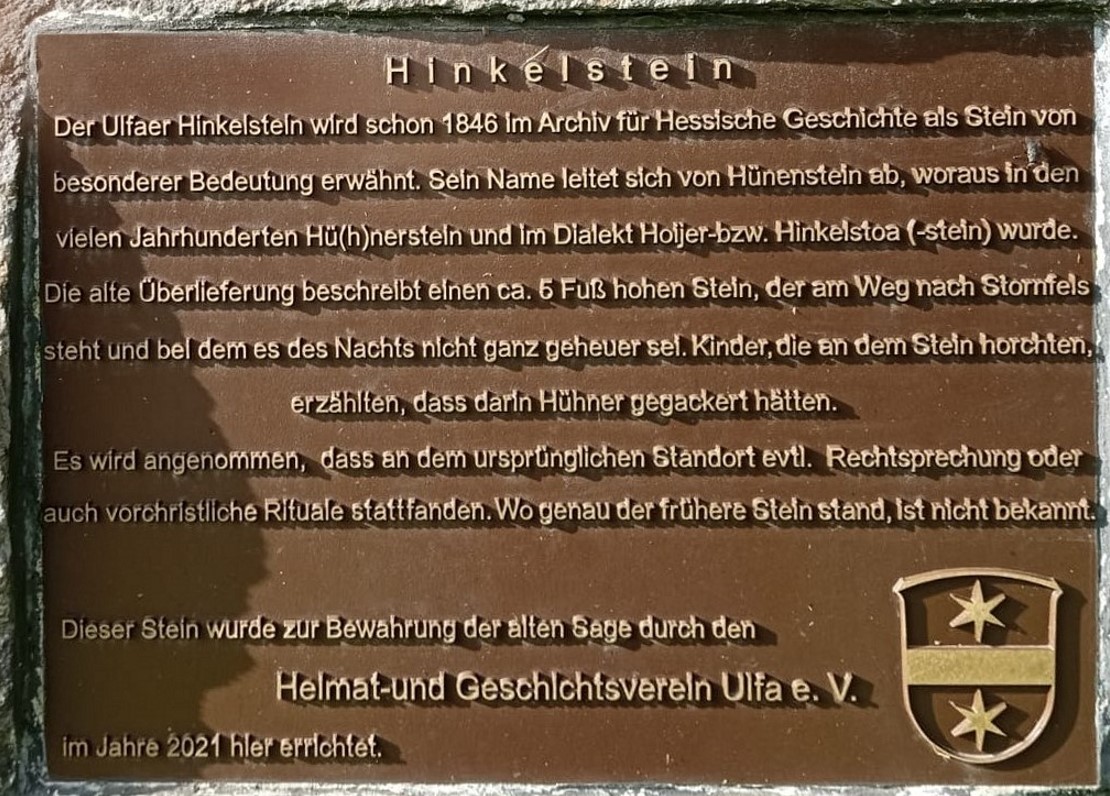 Der unvoreingenommene Besucher
fragt sich
natürlich, ob der Radabweiser-Hinkelstein nicht der
anscheinend
verschwundene Hinkelstein sein könne. -->
Hier ein Bericht der FNP über die Aufstellung des
neuen Steins.
Der unvoreingenommene Besucher
fragt sich
natürlich, ob der Radabweiser-Hinkelstein nicht der
anscheinend
verschwundene Hinkelstein sein könne. -->
Hier ein Bericht der FNP über die Aufstellung des
neuen Steins.