Die Jagdsteine bei Messel
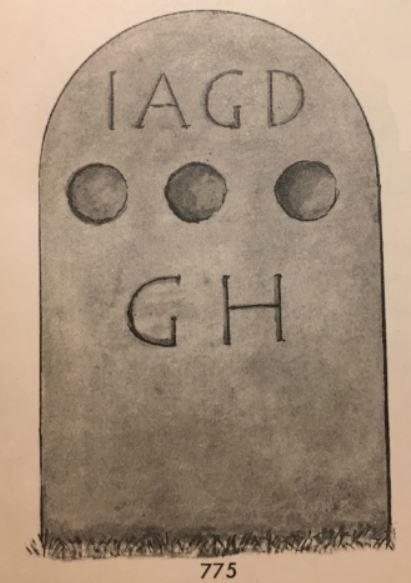

Man unterscheidet bei Grenzsteinen
zwischen Territorialsteinen
(Landesgrenzsteine), Gemarkungssteinen, Gütersteinen und
Grenzsteinen besonderer Art. Auf dieser Website werden von letzteren
die
Rottensteine (Grenzen der Zuständigkeitsbezirke für
die
Deichunterhaltung), die Schäfersteine und die
Waldabteilungssteine
beschrieben. In diesem Kapitel wollen wir und mit Jagdsteinen
beschäftigen. Es gibt in der einschlägigen Literatur
nur
wenige konkrete Hinweise auf diese Grenzsteinart. In Lit. Zorn (Nr.775)
wird beschrieben:
"Diese
Steine grenzten früher die einzelnen
Jagdgebiete in größeren Wäldern
ab, die zu keiner
Ortsgemarkung gehörten. Nr. 775 stand im Walde zwischen
Urberach
und Messel, findet sich jetzt an der Landstraße,
wo der
Steinweg
einmündet. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein zu
Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei
Löcher. GH -
Großherzogtum Hessen, Rückseite zeigt VA,
wohl Namen
eines Adeligen, Keuper 37 × 17 × 59 cm."
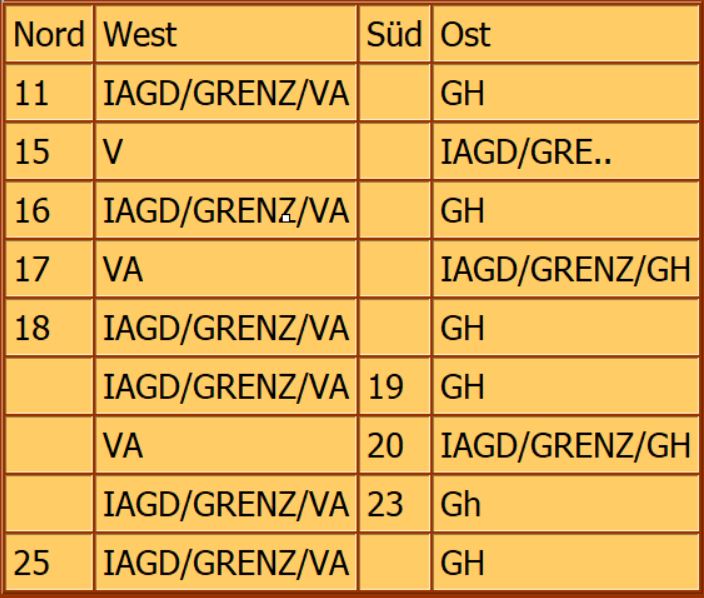
Der
Messeler Heimatforscher Karl Wenchel informierte mich, dass es neben
den oben beschriebenen Steinen am Knick der Landesstraße an
der
Einmündung des Steinwegs noch weitere dieser Steine in dem
Waldstück
gäbe. Meine ersten Erkundungen scheiterten an den Warnungen
der
Herren vom Kampmittelräumdienst, die dort tätig
waren.
Erst im
März 2018 hatte ich wieder die Gelegenheit, nach den Steinen
zu
suchen. In mehreren Anläufen fand ich insgesamt 11 Steine. Sie
bestehen aus Rotliegendem (und nicht aus Keuper, wie Zorn meinte), sind
insgesamt 100 cm hoch (60 cm Kopf und 40 cm Fuß), 36-37 cm
breit
und
17-19 cm tief. Der Kopf ist halbrund und zeigt keine Weisung. Wegen des
relativ kurzen Fußes stehen die meisten Steine mehr oder
weniger
schief. Sie sind auf der Schmalseite mit einer fortlaufenden Nummer
versehen: 5, 6 (die "Banksteine" an der Landesstraße), 10
(herausliegend), 11, 15 - 20, 23 und 25. Auf der Vorder- und
Rückseite tragen sie Inschriften, die z.T. stark
verwittert
sind: IAGD/GRENZ/VA, GH und IAGD/GRENZ/GH, VA. Die Seite auf
der
VA vorkommt, ist stets Richtung Westen/Süden, d. h. Richtung
Messel gerichtet. In der Regel wechseln sich die Bezeichnungen ab,
allerdings sind die Steine 18 und 19 gleichartig ausgeführt
(s. Tabelle). Die
Zahlen auf den Seiten sind ohne erkennbares System verteilt. Das "N" in
Grenz ist seitenverkehrt dargestellt.
 |
 |
 |
 |
Stein 6
IAGD/OOO/GH |
Stein
10
IAGD/GRENZ/GH |
Stein
19
19 |
Stein
23
IAGD/GRENZ/VA |
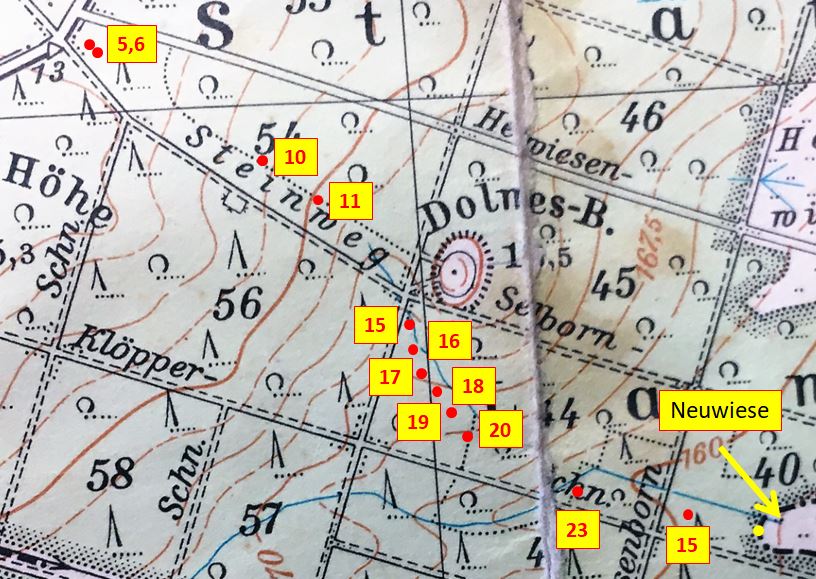
Die
ungefähre Lage der Steine ist auf einem Ausschnitt
des
Messtischblatts Langen aus dem Jahr 1963 eingetragen (damals waren die
Messtischblätter noch richtig gut). Links oben
erkennt
man die L 3097. Im Zwickel vom Steinweg und der Hellwiesenschneise
stehen die beiden Banksteine. Der umliegende Stein 10 ist nicht leicht
zu finden, im Gegensatz zu dem aufrecht stehenden Stein 11, der ca. 10
m
südwestlich eines flachen Grabens an einer geraden Reihe von
Eichenbäumen steht. Auf der Karte ist dort eine gepunktete
Linie
eingetragen. Ein Blick auf ein älteres Messtischblatt zeigt,
dass
es sich um einen ehemaligen Weg vom Steinbruch am Dolmesberg in
Richtung der Landesstraße handeln könnte. Stein 15
steht
unübersehbar an einem (trockenen) Graben östlich der
Weizenbornschneise knapp 40 m südlich der Kreuzung mit dem
Steinweg/Sellbornschneise. Die Steine 16 bis 20 findet man in
Abständen von rund 50 m aufgereiht etwas südlich des
Grabens.
Dieser Graben ist bei Stein 20 nicht mehr zu erkennen. Um an Stein 23
zu gelangen, muss man den aus Südwesten kommenden
wasserführenden
Graben überqueren. Stein 25 befindet sich in ca. 100 m
Entfernung von Stein 23 ca. 30 m östlich der
Eisenbornschneise südlich dieses Wassergrabens.
Jede Grenze hat einen Anfang und ein Ende. Wir haben festgestellt, dass
die durchschnittliche Entfernung zwischen zwei Steinen ca. 50 m
beträgt. Der Abstand von Stein 10 zu den Banksteinen
misst
ca. 400 m. Da passen gut noch 9 Steine hinein. Von Stein 23 bis zur 90
Grad-Ecke der Neuwiese (gelber Punkt auf der Karte) ist die Entfernung
ca. 100 m. An dieser Ecke ist
leider kein Grenzstein vorhanden. Aus diesen Überlegungen kann
man
schießen, dass diese Grenze von dem Knick
der Landesstraße
Messel-Urberach bis zur Neuwiese führt. Sie hat eine
Länge von ca. 1300 m und war mit insgesamt 27 Grenzsteinen
markiert, von denen heute noch 11 existieren.

Im
Gebiet des heutigen Kreises Offenbach gab es verschiedene Waldmarken,
d.h. Waldareale, die den angrenzenden Gemeinden gemeinsam
gehörten: Biebermark, Auheimer Mark, Rödermark,
Babenhäuser Mark, Dieburger Mark. Die Einwohner dieser
Gemeinden
hatten
eingeschränktes Recht, den Wald z.B. zum Holzschlagen oder zum
Viehtrieb zu nutzen. Zusammen mit den ungenügenden
Erhaltungsmaßnahmen führte dies zum
Niedergang des
Waldbestandes. Die Waldmarken wurden daher um 1820 unter den
beteiligten Gemeinden
aufgeteilt und der Wald der Großherzoglichen Forstverwaltung
unterstellt. Die Karte links (Geoportal Hessen) zeigt die heutigen
Gemarkungsgrenzen, die praktisch identisch sind mit
denen, die
durch
die Markwaldteilung entstanden sind. Allerdings gab es damals noch eine
eigenständige Gemarkung "Forst Eichen", die erst um 1951 zur
Gemarkung Eppershausen kam. Diese Gemarkung war nicht Teil der
Rödermark, sie war Eigentum der
Mainzer Kurfürsten.
Durch die
Skularisierung gelangte sie 1803 in den Besitz von Hessen-Darmstadt.
Heute ist das Gebiet
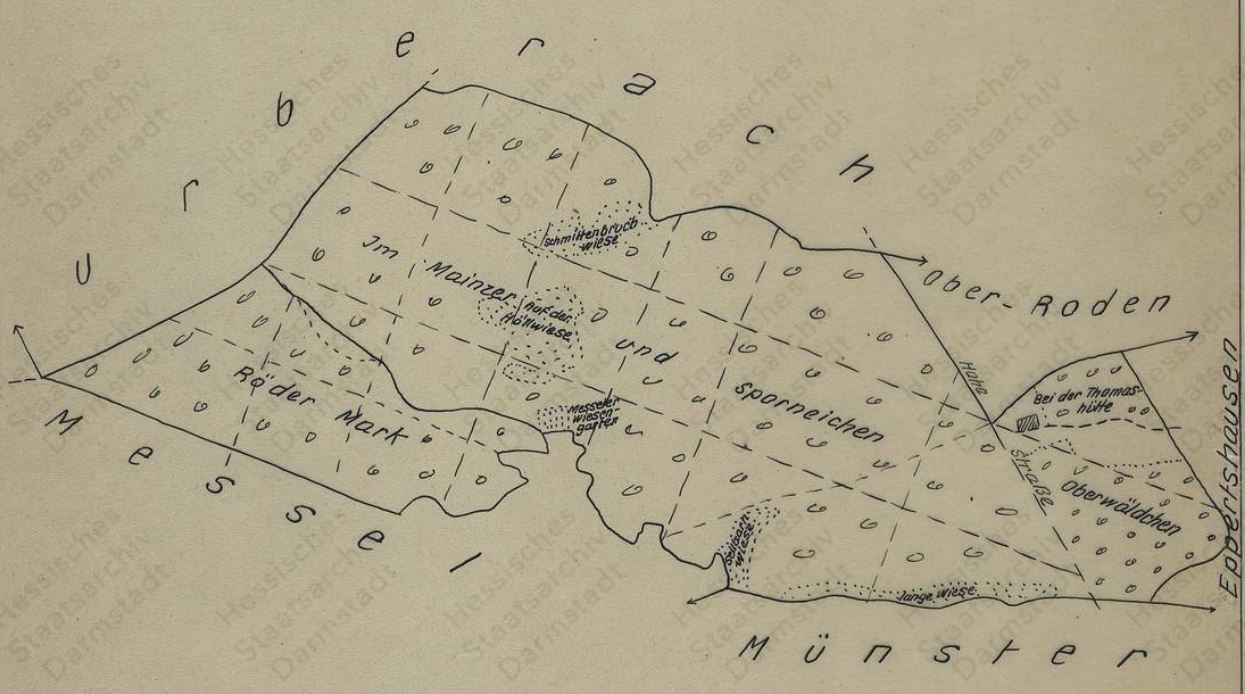
Staatswald. Die Jagdgrenze
verläuft durch
diese Gemarkung. Sie beginnt an dem Knick der Landesstraße,
welche die Grenze zu Urberach bildet. Sie endet an einem Knick der
Neuwiese an der Gemarkungsgrenze zu Messel. Die Neuwiese war nicht Teil
der
Rödermark, sie gehörte zum größten
Teil Messeler Bürgern. Bei der Festlegung der
Gemarkungsgrenzen blieb sie bei Messel.
Interessant
ist in diesem Zusammenhang die Buxbaum-Karte der Gemarkung Forst
Eichen (Situation um 1850). Es sind vier Fluren zu erkennen: Bei der
Thomashütte,
Oberwäldchen, Im Mainzer und Sporneichen sowie
Rödermark. Und
siehe da, die Grenze zwischen der Flur Im Mainzer und Sporneichen und
der Flur Rödermark entspricht unserer Jagdgrenze. Es spricht
einiges dafür, dass bei der Markwaldteilung das mit
"Rödermark" bezeichnete Gelände als neue
Flur zur
Gemarkung Forst Eichen kam. Der Wald auf Messeler Gemarkungsgebiet ist
Gemeindewald.
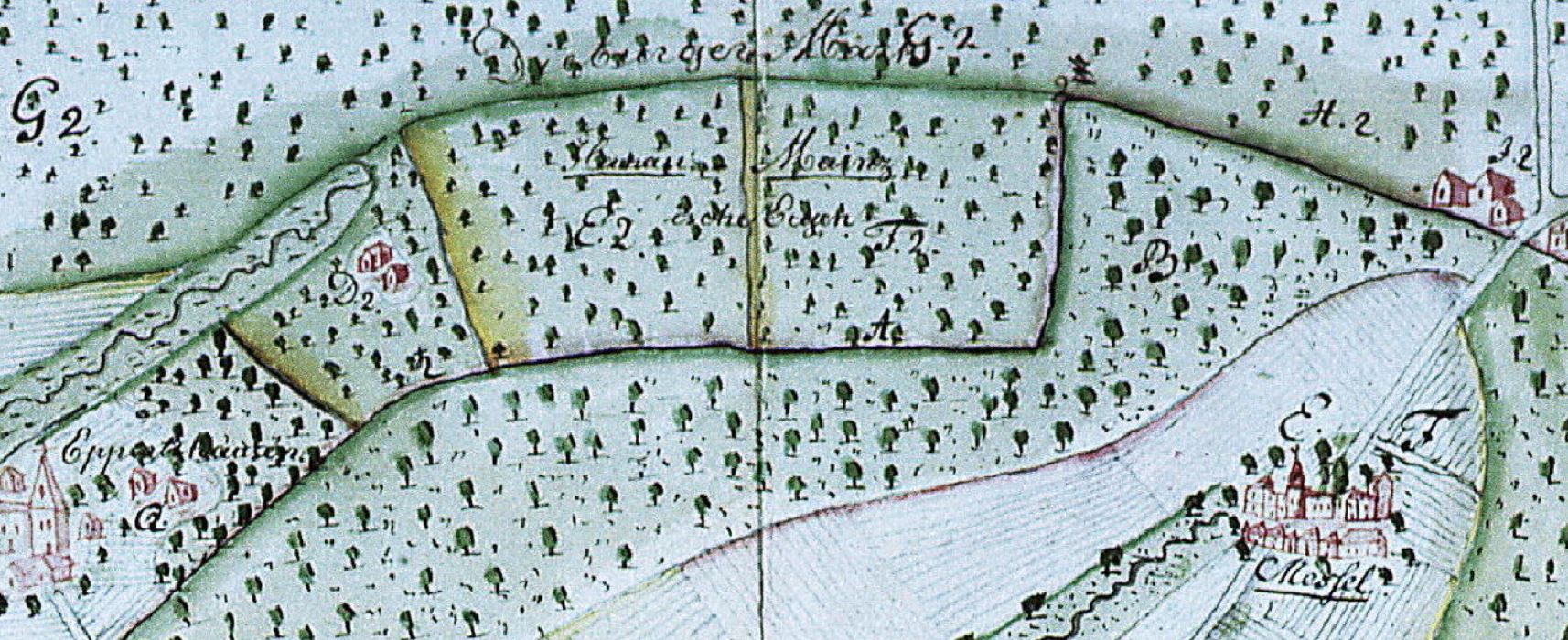
Auf
einer Karte der Rödermark von 1740 (HStA, P1, 804) erkennt man
bei
Messel zwei Gebiete, die
Hanauer und Mainzer
Eichen genannt werden
und die weder zur Röder- noch zur Dieburger Mark
gehörig
sind. Daraus ist der Domanialwald der selbstständigen
Gemarkung
"Forst Eichen" des Großherzogtums Hessen geworden. Der
Mainzer
Teil könnte 1803 durch die Säkularisierung an die
Landgafschaft Hessen-Darmstadt gefallen sein, der Hanauer Teil nach
dem Aussterben der Hanauer Linie im Jahr 1736 (bzw. nach
Beendigung des Rechtsstreites mit Hessen-Kassel im Jahr 1771). Falls
der Hanauer Teil im
Amt
Babenhausen (Hessen-Kassel) verblieben wäre,
würde es dann doch 1810 zum Großherzogtum
Hessen gekommen sein.
Das Dorf Messel war jahrhundertelang im Besitz der Familie von
Groschlag. Nachdem das letzte männliche Mitglied der
Familie
1799
verstorben war, wurde Messel als Lehen an den Kurmainzischen
Staatsminister Franz Joseph Martin von Albini (1748-1816) vergeben. Er
blieb allerdings nur bis 1806 Ortsherr von Messel, dann wurde die
Gemeinde
in das Großherzogtum Hessen einverleibt. Bis zur
Märzrevolution 1848
hatten
die Nachkommen Albinis bestimmte Standesrechte. In Lit. Raab, Wenchel
et al. ist
diese komplexe und hochinteressante Geschichte ausführlich
beschrieben.
Die Jagdsteine sind wie oben erwähnt
mit FORST / GRENZ,
GH, VA und
einer fortlaufenden Nummer beschriftet. GH bedeutet
Großherzogtum
Hessen. Sie können daher erst nach 1806 gesetzt worden sein.
VA kann eigentlich nur "von Albini" heißen.
Im Staatsarchiv in Darmstadt existiert eine Gerichtsakte aus den Jahren
1821/23 (G320, 1120): Freifrau von Albini vs.
Großherzogliche Forstverwaltung. Hierin ging es um "
Störung
im Besitz des Mitjagdrechtes
in der Röder und Dieburger Mark, sowie in der
Dieburger und Kleinzimmerer Gemarkung."
In dem vorliegenden Teil des transkribierten Dokuments wird von der
Freifrau von Albini, der Witwe von Franz Joseph Martin von Albini,
verlangt, dass sie Beweise dafür bringt, über
Mitjagdrechte
in dem genannten Gebiet zu verfügen.
Ich konnte bisher kein abschließendes Urteil in dem
handschriftlichen Konvolut finden, aber man kann wohl davon ausgehen,
dass die Freifrau von Albini nach Prozessende nicht nur Jagdrechte in
der neugeschaffenen Gemarkung Messel besaß (in der die
Familie
trotz Zugehörigkeit zum Großherzogtum Standesrechte
innehatte), sondern auch darüber hinaus auch in der
benachbarten Gemarkung Forst Eichen bis zur ehemaligen
Rödermarkgrenze. Ihr Jagdbezirk dort wurde dann
wahrscheinlich um 1824 sehr
aufwändig abgesteint. Dies erscheint alles sehr plausibel; ein
Beweis ist es noch nicht. Vielleicht finden sich in den Archiven
weitergehende Informationen.
 Man unterscheidet bei Grenzsteinen
zwischen Territorialsteinen
(Landesgrenzsteine), Gemarkungssteinen, Gütersteinen und
Grenzsteinen besonderer Art. Auf dieser Website werden von letzteren
die
Rottensteine (Grenzen der Zuständigkeitsbezirke für
die
Deichunterhaltung), die Schäfersteine und die
Waldabteilungssteine
beschrieben. In diesem Kapitel wollen wir und mit Jagdsteinen
beschäftigen. Es gibt in der einschlägigen Literatur
nur
wenige konkrete Hinweise auf diese Grenzsteinart. In Lit. Zorn (Nr.775)
wird beschrieben: "Diese
Steine grenzten früher die einzelnen
Jagdgebiete in größeren Wäldern
ab, die zu keiner
Ortsgemarkung gehörten. Nr. 775 stand im Walde zwischen
Urberach
und Messel, findet sich jetzt an der Landstraße,
wo der
Steinweg
einmündet. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein zu
Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei
Löcher. GH -
Großherzogtum Hessen, Rückseite zeigt VA,
wohl Namen
eines Adeligen, Keuper 37 × 17 × 59 cm."
Man unterscheidet bei Grenzsteinen
zwischen Territorialsteinen
(Landesgrenzsteine), Gemarkungssteinen, Gütersteinen und
Grenzsteinen besonderer Art. Auf dieser Website werden von letzteren
die
Rottensteine (Grenzen der Zuständigkeitsbezirke für
die
Deichunterhaltung), die Schäfersteine und die
Waldabteilungssteine
beschrieben. In diesem Kapitel wollen wir und mit Jagdsteinen
beschäftigen. Es gibt in der einschlägigen Literatur
nur
wenige konkrete Hinweise auf diese Grenzsteinart. In Lit. Zorn (Nr.775)
wird beschrieben: "Diese
Steine grenzten früher die einzelnen
Jagdgebiete in größeren Wäldern
ab, die zu keiner
Ortsgemarkung gehörten. Nr. 775 stand im Walde zwischen
Urberach
und Messel, findet sich jetzt an der Landstraße,
wo der
Steinweg
einmündet. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein zu
Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei
Löcher. GH -
Großherzogtum Hessen, Rückseite zeigt VA,
wohl Namen
eines Adeligen, Keuper 37 × 17 × 59 cm."