Die Grenzsteine um den Schönborner Wald
 Der frühere
Schönborner Wald, auch als Gravenbrucher
Wald bezeichnet, umfasste die heutige Wohnstadt Gravenbruch und die
davon südlich liegenden Waldungen bis zur Dietzenbacher
Gemarkung. Um die Historie dieses Waldes zu verstehen, ist es
erforderlich, sich mit der Geschichte
Heusenstamms
zu beschäftigen. 1211 ging das Dorf als Reichslehen von den
Herren
von Hagen-Münzenberg an die Herren von Eppstein. Von diesen
wurden
wiederum die Ritter von Heusenstamm belehnt. Heusenstamm hatte eine
wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen. Im
Dreißigjährigen Krieg wurde es fast
vollständig
zerstört. Seuchen dezimierten die Bevölkerung
zusätzlich. 1661 verkauften die Herren von Heusenstamm das
verarmte Dorf an die Herren von Schönborn. Die Herrschaft
dieser
kunstsinnigen und baufreudigen Familie endete 1806, als dieses Gebiet
mediatisiert und dem Fürstentum Isenburg zugesprochen wurde.
1816
wurde bei der Neuordnung Deutschlands im Zuge des Wiener Kongresses das
Fürstentum Isenburg vom Großherzogtum Hessen
übernommen.
Der frühere
Schönborner Wald, auch als Gravenbrucher
Wald bezeichnet, umfasste die heutige Wohnstadt Gravenbruch und die
davon südlich liegenden Waldungen bis zur Dietzenbacher
Gemarkung. Um die Historie dieses Waldes zu verstehen, ist es
erforderlich, sich mit der Geschichte
Heusenstamms
zu beschäftigen. 1211 ging das Dorf als Reichslehen von den
Herren
von Hagen-Münzenberg an die Herren von Eppstein. Von diesen
wurden
wiederum die Ritter von Heusenstamm belehnt. Heusenstamm hatte eine
wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen. Im
Dreißigjährigen Krieg wurde es fast
vollständig
zerstört. Seuchen dezimierten die Bevölkerung
zusätzlich. 1661 verkauften die Herren von Heusenstamm das
verarmte Dorf an die Herren von Schönborn. Die Herrschaft
dieser
kunstsinnigen und baufreudigen Familie endete 1806, als dieses Gebiet
mediatisiert und dem Fürstentum Isenburg zugesprochen wurde.
1816
wurde bei der Neuordnung Deutschlands im Zuge des Wiener Kongresses das
Fürstentum Isenburg vom Großherzogtum Hessen
übernommen.Die Besitzverhältnisse der Waldungen um Heusenstammm waren sehr komplex. Das Dorf gehörte zur Biegermark, d.h. es gab ein ausgedehnter Waldgebiet, das den beteiligten Dörfern gemeinsam gehörte (= Markgenossenschaft). Dieser gemeinsame Besitz wurde von den beteiligten Parteien exzessiv genutzt: der Wald verkam zu einer verbuschten Heidelandschaft. 1819 wurde daher auf großherzoglichen Befehl dieser Markwald unter den Besitzern aufgeteilt, darunter auch auf die damals selbstständige Gemarkung Patershausen. Aus dieser Waldteilung ging auch die südlich von Heusenstamm liegende Offenbacher Wald-Enklave "Hintermark" hervor (Lit: Kurt). Heute befindet sich dort ein Offenbacher Wasserwerk. Auch Heusenstamm erhielt seinen Anteil bei der Waldteilung.
Westlich von Heusenstamm liegt der Gravenbrucher Wald, der früher eine eigenständige Gemarkung war. Interessanterweise ordnet Nahrgang den Gravenbrucher Wald der Urmark Sprendlingen zu. Dabei ist anzumerken, dass um 1250 das Dorf Sprendlingen und die Waldungen nördlich von Sprendlingen, die als "Heusenstammer Wald" bezeichnet wurden, den Herren von Heusenstamm gehörten. Achtung: Nach Lit Lenhard (2) hatten die Herren von Heusenstamm im 13. Jh. Vogtei, Gericht und Kirchsatz von Sprendlingen als Katzenelbogisches Lehen. Weiter heißt es dort, dass der Wald in den ersten Jahrzehnten des 13. Jh. von Philipp von Falkenstein käuflich erworben wurde. Ludwig der Bayer habe das Lehen übertragen.
Im Jahr 1418 belehnte Kaiser Rupprecht den Eberhard von Heusenstamm mit dem Wald .."der heißt das Kreienbruch und das Craenbirke ...". Obwohl dieser Wald ein besonderes kaiserlichesLehen war, wurde der Gravenbrucher Wald 1661 ebenfalls an die Herrn von Schönborn verkauft. Seitdem war er als "Schönborner Wald "Domanialwald, d.h. Privatbesitz der Familie von Schönborn. Westlich dieses Waldes erstreckte sich der Forst Dreieich, Revier Sprendlingen, d.h. der Domanialwald der Fürsten von Isenburg. Das Waldgebiet nördlich zwischen Heusenstamm und dem Schönborner Wald ist der "Deutschherrenwald", der sich im Besitz der Deutschordens-Commende Frankfurt befand. 1806 wurde er mediatisiert/säkularisiert, dem Fürstentum Isenburg zugeordnet und bildete ab dann die gemeindefreie Gemarkung Wildhof. Wahrscheinlich erhielt Heusenstamm damals einen Streifen Waldes im Süden, um einen direkten Zugang zum Schönborner Wald zu haben. Dieser Wald heißt heute noch "Deutschherrenwald). 1816 wurde das Isenburger Territorium hessisch; die Großherzoge wurden Eigentümer der Gemarkung Wildhof. Eine Karte des Wildhofgebietes von 1731 ist -->hier abzurufen, eine weitere von 1738 (Fertigung 1809) -->hier. Oben erkennt man den Standort des Dreiherrensteins (s. unten), in der Mitte liegt der Wildhof, rechts oben schlängelt der Hainbach.
 Im Hessischen
Staatsarchiv in Darmstadt wird eine sehr schöne
Karte des
"Creenbrucher" Waldes aus dem Jahr 1585 aufbewahrt. Sie ist nach
Süden
ausgerichtet. Sehr gut erkennt man die umliegenden Wälder:
Unten den "Ofenbacher Waldt", rechts den
"Sprendlinger Waldt" und oben den "Getzenhainer Waldt". Diese
Gebiete sind
mit dem Isenburger Wappen gekennzeichnet (weißer Schild mir
zwei schwarzen Streifen). Links mittig steht
"Teutsche Hern Waldt / die Hambach" (mit dem Deutschordenskreuz), links
oben "Bigermarck". Das Dietzenbacher Gebiet (der
Zwickel oben) ist nicht bezeichnet. Das Wappen der Herren von
Heusenstamm (Roter Schild, untere Hälfte Silber in drei Zacken
auslaufend, Lit. Wimmer, S. 119) findet sich mehrfach in dem
Gebiet, ebenso links in der Nähe von Heusenstamm. Sehr
schön mit drei
(kleinen) Wappen ist der Standort des Dreiherrensteins gekennzeichnet.
Interessant sind auch die auf dem Detailbild
erkennbaren Mainzer Wappen sowie die kleinen Reiter und
Fußgänger, die sich Richtung Sprendlingen bewegen.
Eindrucksvoll sind die 55 nummerierten Grenzsteine abgebildet,
welche
die Grenze des
Gebietes markierten.
Im Hessischen
Staatsarchiv in Darmstadt wird eine sehr schöne
Karte des
"Creenbrucher" Waldes aus dem Jahr 1585 aufbewahrt. Sie ist nach
Süden
ausgerichtet. Sehr gut erkennt man die umliegenden Wälder:
Unten den "Ofenbacher Waldt", rechts den
"Sprendlinger Waldt" und oben den "Getzenhainer Waldt". Diese
Gebiete sind
mit dem Isenburger Wappen gekennzeichnet (weißer Schild mir
zwei schwarzen Streifen). Links mittig steht
"Teutsche Hern Waldt / die Hambach" (mit dem Deutschordenskreuz), links
oben "Bigermarck". Das Dietzenbacher Gebiet (der
Zwickel oben) ist nicht bezeichnet. Das Wappen der Herren von
Heusenstamm (Roter Schild, untere Hälfte Silber in drei Zacken
auslaufend, Lit. Wimmer, S. 119) findet sich mehrfach in dem
Gebiet, ebenso links in der Nähe von Heusenstamm. Sehr
schön mit drei
(kleinen) Wappen ist der Standort des Dreiherrensteins gekennzeichnet.
Interessant sind auch die auf dem Detailbild
erkennbaren Mainzer Wappen sowie die kleinen Reiter und
Fußgänger, die sich Richtung Sprendlingen bewegen.
Eindrucksvoll sind die 55 nummerierten Grenzsteine abgebildet,
welche
die Grenze des
Gebietes markierten. | Der folgende Exkurs soll
die Grenzänderungen in diesem Gebiet
etwas ausführlicher behandeln. Er gibt Antwort auf die Frage,
wie
der Schönbornsche Wald und der Wildhof aufgeteilt wurden und
warum
das Offenbacher Stadtgebiet so weit in den Kreis Offenbach hineinragt.
Ich danke Herrn Scheuern von Stadtarchiv Heusenstamm für die
freundliche Unterstützung. Im Juli 1955 beschloss die Hessische Staatsregierung die gemeindefreien Gemarkungen aufzulösen, d. h. diese Gebiete mussten einer Gemeinde zugeordnet werden. Patershausen, der Heusenstammer Forst (zwischen der L 3405 und der Bahnlinie) und der Wildhof kamen zu Heusenstamm. Um die Gemarkung Gravenbruch (= Schönborner Wald) gab es heftiges Hauen und Stechen. Der nördliche Teil wurde Neu-Isenburg zugeteilt, wo später die Wohnstadt Gravenbruch gebaut wurde. Sprendlingen erhielt den Teil westlich der B 459, Heusenstamm den Teil östlich davon. Es gab Klagen gegen den Beschluss der Landesregierung, denn die Grundbesitzer der vorher gemeindefreien Gemarkungen mussten jetzt Gemeindesteuern (Grundsteuer) zahlen. Im März 1964 entschied das Bundesverwaltungsgericht im Falle des Neuhofs (Egon Schumacher war einer der Kläger), dass die die Entscheidung der Landesregierung nicht rechtmäßig war. Auch der Besitzer des Wildhofsgeländes, die Hessische Hausstiftung, hatte dagegen geklagt. Konsequenterweise wurde von der Regierung im Dezember 1964 die Zuordnung der Gemarkung Wildhof zu Heusenstamm aufgehoben. Die Stadt Offenbach hatte im April 1964 mit der - aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbaren - Begründung, den Erholungswald für die Bürger Offenbachs sichern zu wollen, für knapp 30 Millionen Mark fast das gesamte Wildhofgelände (mit Ausnahme des Hofgutes bzw. der Gaststätte ) von der Hessischen Hausstiftung gekauft. Für Zins und Tilgung musste die schon damals klamme Stadt über 2 Millionen Mark aufbringen. Mit großem Engagement verlangte der Magistrat der Stadt Offenbach daraufhin, dass die damals zu Heusenstamm gehörende Gemarkung Wildhof dem Offenbacher Stadtgebiet zugeordnet werden sollte. Das führte bei der Stadt Heusenstamm und beim Kreis Offenbach zu heftiger Gegenwehr. Heusenstamm wäre von Offenbacher Gemarkungsgebiet umgeben; man fürchtete die Expansionsbestrebungen Offenbachs. Es ist hochinteressant, den damaligen Schlagabtausch nachzuvollziehen. Nach zweijährigem Stellungskrieg einigte man sich im März 1966 durch einem Kompromiss: Es soll nochmals betont werden, dass die gemarkungsmäßige Zugehörigkeit nichts über die realen Besitzverhältnisse aussagt. So waren sowohl der Schönborner Wald als auch Patershausen (und das Heusenstammer Schloss) Privateigentum der Familie von Schönborn. Die Baugesellschaften mussten das Gelände der Wohnstadt Gravenbruch vom Grafen kaufen. 1978 erwarb die Stadt Heusenstamm von Rudolf Graf von Schönborn das Hofgut Patershausen mit Feld, den Klosterwald und den Heusenstammer Wald. Im gleichen Jahr kaufte die Stadt Frankfurt den Schönbornschen Wald (Forstrevier Grafenbruch). Dieser Teil des Frankfurter Stadtwaldes liegt in drei Gemarkungen: Sprendlingen, Heusenstamm und Offenbach. Die Hintermark, auf Heusenstammer Gemarkungsgebiet liegend, ist Eigentum der Stadt Offenbach (Wasserwerk). Eine weitere Anmerkung sei gestattet: Wie oben erwähnt, wurde der Deutschherrenwald 1806 säkularisiert und kam in den Besitz der Isenburger Fürsten. Auf dem Wiener Kongress wurden die Isenburger Territorien dem Großherzogtum Hessen zugeschlagen. Die Gemarkung Wildhof wurde auf irgendeine Weise Domanialwald, d.h. Privatbesitz des Großherzogs. 1918 wurde der Großherzog abgesetzt. Das Eigentum des Fürstenhauses wurde 1928 in die Kurhessische Hausstiftung (seit 1986 Hessische Haustiftung) eingebracht, da die Weimarer Verfassung die Auflösung des fürstlichen Privatbesitzes forderte und der Besitz andernfalls verstaatlicht worden wäre. Vor diesem Hintergrund ist es unsäglich, dass der Offenbacher Steuerzahler fast 30 Millionen Mark für ein säkularisiertes Gebiet aufbringen musste, das auf diese Weise in den Privatbesitz des Großherzogs gekommen ist. Was noch dazukommt: Der Steuerzahler alimentiert heute noch die Kirchen mit knapp einer halben Milliarde Euro jährlich für die Verluste, welche sie durch die Säkularisierung angeblich erlitten haben. Der Vollständigkeit halber: 1900 verkaufte der Fürst zu Isenburg seine Forstreviere Offenbach und Sprendlingen und 1929 die Forstreviere Götzenhain und Offenthal an den Hessischen Staat. Auch diese Gebiete waren früher Reichslehen, die irgendwann zu Privatbesitz wurden Die Steine, welche die Grenze der Gemarkung Wildhof anzeigten, stehen z.T. noch in den Wäldern. Frau Luise Hubel hat sie 2004 dokumentiert. Bei Bedarf kann ich ihre Unterlagen zur Verfügung stellen. |
Die erste Fassung dieses Textes wurde 12/2013 publiziert.
Der Grenzsteinspaziergang
Anschauen in Google Earth
Wir beginnen unseren Spaziergang an der Polizeistation am Dreiherrensteinplatz in der Wohnstadt Gravenbruch. In der Grünanlage vor der Polizeistation steht der Namensgeber des Platzes: der Dreiherrenstein. Er stand früher 200 m weiter nördlich Richtung Autobahn am Schnittpunkt der Gebiete der Fürsten von Isenburg-Birstein, der Grafen von Schönborn und
Vor der Polizeistation stehen noch zwei weitere Steine aus hellem Sandstein. Der zweite Stein ist mit "Y" auf der einen und einem Quadrat mit einem innenliegenden "S " (?) und außenliegenden "SB" auf der anderen Seite gekennzeichnet. Auf dem Kopf ist eine "68" eingemeißelt. Der dritte Stein an dieser Stelle ist vergleichsweise unauffällig: Er ist mit der Zahl "72" sowie "SB" (recht schmucklos) versehen. Darunter kann man zwei Zeichen erahnen, die "17" bedeuten könnten. Auf dem Kopf sind Zeichen zu erkennen, die man bei schrägem Lichteinfall mit "69" interpretieren kann. Diese beiden Steine standen wahrscheinlich früher in der Nähe des Dreiherrensteins (s. Nummerierung: 68, 70, 72).
Anmerkung 3/2020: Die Polizeistation in Gravenbruch wurde abgerissen und die drei Steine in den Hof des Hauses zum Löwen, dem Stadtmuseun Neu-Isenburgs, verbracht.
 Wir folgen dem
Waldrand und kommen am
ehemaligen Standplatz des Steines Nr. 72 vorbei, der wie
erwähnt, jetzt vor der
Polizeistation steht. Kurz vor einem links abzweigenden
Waldweg
stoßen wir linkerhand auf den ersten Stein auf einem
Grenzpunkt dieser
Grenzlinie. Er besteht aus dunkel gewordenem ehemals hellen Sandstein
und besitzt einen stark
gewölbten Kopf. Auf der Vorderseite ist das
Schönborner
Löwenwappen
(sowie SB 1730) eingemeißelt, die Rückseite ist mit
dem
Signet der Commende Frankfurt (1730) versehen. Interessant ist die
Beschriftung der NW-Seite ("76"), der SO-Seite ("13") und des Kopfes
("65").
Auf diese Nummerierung wird
weiter unten eingegangen. 120 m weiter steht der nächste Stein
der
Serie. Er ist mit "77" und "12" nummeriert. Der Kopf ist leicht
beschädigt. Auf
Wir folgen dem
Waldrand und kommen am
ehemaligen Standplatz des Steines Nr. 72 vorbei, der wie
erwähnt, jetzt vor der
Polizeistation steht. Kurz vor einem links abzweigenden
Waldweg
stoßen wir linkerhand auf den ersten Stein auf einem
Grenzpunkt dieser
Grenzlinie. Er besteht aus dunkel gewordenem ehemals hellen Sandstein
und besitzt einen stark
gewölbten Kopf. Auf der Vorderseite ist das
Schönborner
Löwenwappen
(sowie SB 1730) eingemeißelt, die Rückseite ist mit
dem
Signet der Commende Frankfurt (1730) versehen. Interessant ist die
Beschriftung der NW-Seite ("76"), der SO-Seite ("13") und des Kopfes
("65").
Auf diese Nummerierung wird
weiter unten eingegangen. 120 m weiter steht der nächste Stein
der
Serie. Er ist mit "77" und "12" nummeriert. Der Kopf ist leicht
beschädigt. Auf  Bevor
wir die Alte Babenhäuser Straße weitergehen, wollen
wir uns
kurz mit der Nummerierung der Steine beschäftigen. Es gibt bei
den
9 Steinen offensichtlich drei Zahlenserien. Die blau unterlegten Zahlen
sind auf den Steinen zu entdecken, die gelb unterlegten sind
extrapoliert. Das ist ein recht logisches Bild. Was bedeuten diese
Reihen? Eine Hypothese ist, dass die erste Reihe die durchlaufende
Nummerierung der Steine um den Schönborner Wald darstellt.
Diese
Zählung beginnt an der Südostecke des Waldes
mit dem
Grenzstein Nr. 1 (s. unten). Die zweite Reihe der Tabelle
könnte
die Zählung von neu gesetzten Steinen sein. Die dritte Reihe
(57-71) bedeutet die Zählung der Steine um den
Deutschherrenwald. Der Stein nordwestlich des Standortes des
Dreiherrensteins trägt die Nummer 72. Interessant ist
der
Vergleich mit der oben erwähnten historischen Karte. Dort
beginnt
die Zählung mit dem Stein Nr. 1 an der Südostecke des
Geländes. Allerdings hat der Vierherrenstein
auf der Karte
die Nummer 31. Das passt leider nicht. Dies bedeutet, dass die
Nummerierung der Grenzpunkte sich zwischen 1600 und 1730
geändert
haben muss.
Bevor
wir die Alte Babenhäuser Straße weitergehen, wollen
wir uns
kurz mit der Nummerierung der Steine beschäftigen. Es gibt bei
den
9 Steinen offensichtlich drei Zahlenserien. Die blau unterlegten Zahlen
sind auf den Steinen zu entdecken, die gelb unterlegten sind
extrapoliert. Das ist ein recht logisches Bild. Was bedeuten diese
Reihen? Eine Hypothese ist, dass die erste Reihe die durchlaufende
Nummerierung der Steine um den Schönborner Wald darstellt.
Diese
Zählung beginnt an der Südostecke des Waldes
mit dem
Grenzstein Nr. 1 (s. unten). Die zweite Reihe der Tabelle
könnte
die Zählung von neu gesetzten Steinen sein. Die dritte Reihe
(57-71) bedeutet die Zählung der Steine um den
Deutschherrenwald. Der Stein nordwestlich des Standortes des
Dreiherrensteins trägt die Nummer 72. Interessant ist
der
Vergleich mit der oben erwähnten historischen Karte. Dort
beginnt
die Zählung mit dem Stein Nr. 1 an der Südostecke des
Geländes. Allerdings hat der Vierherrenstein
auf der Karte
die Nummer 31. Das passt leider nicht. Dies bedeutet, dass die
Nummerierung der Grenzpunkte sich zwischen 1600 und 1730
geändert
haben muss. Weiter geht's. Wir passieren das Gambrechtkreuz, das linkerhand im Wald steht. Die neue Gemarkungsgrenze läuft ein Stück des Weges entlang; wir erkennen erst links und dann rechts jeweils einen modernen Granitgrenzstein, welcher je eine rechtwinklige Änderung des Grenzverlaufs anzeigt. Seltsamerweise sind diese Steine auf den sich gegenüberliegenden Seiten mit "TP" und einem Dreieck gekennzeichnet, was normalerweise für einen Trigonometrischen Punkt steht. An der Kreuzung der Alten Babenhäuser Straße mit der Hohebergschneise findet man einen modernen Granitstein mit einem "M" bzw. "W" auf dem Kopf. Auf der Linken Seite erkennen wir ein Schild mit der Aufschrift "Deutschherrenwald". Wie oben erwähnt, handelt es sich um ein Waldstreifen des ehemaligen Besitzes der Deutschordenscommende der eine "Landverbindung" vom Heusenstammer Gemeindegebiet zum Schönborner Wald gewährleistete. Auf der nördlichen Seite dieses Areals haben wir keine Grenzsteine entdeckt, wohl aber auf der Südseite. Es handelt sich um drei unbeschrifte Granitsteine.
Kurz hinter der Kreuzung der Alten Babenhäuser Straße mit dem Sprendlinger Weg sehen wir auf der rechten Seite einen großen, unregelmäßig geformten Grenzstein.
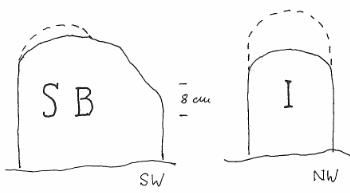 Ein Dietzenbacher
Bürger fand ihn dort herausliegend. Ich hatte mir (11/2013)
erlaubt, ihn provisorisch an der Fundstelle(Grenzpunkt)
wieder
aufzustellen. Der Stein ist unbeschriftet, auf dem Kopf erkennt man
einen eingemeißelten Stern. Nach weitern 500 m erreichen wir
die südöstliche Ecke des
Schönborner Waldes. Dort
steht schräg gegenüber einem stillgelegten Waldbrunnens
der Stein Nr. 1 der Grenzlinie. Er ist aus Rotliegendem, ist
unregelmäßig geformt undmit "SB" und "I"
beschriftet.
Auf den schrägen Kopf ist ein Kreuz eingemeißelt.
Hier
stießen die Gebiete der Schönborner, der Ysenburger
und die
Biegermark, später Hintermark, aneinander.
Ein Dietzenbacher
Bürger fand ihn dort herausliegend. Ich hatte mir (11/2013)
erlaubt, ihn provisorisch an der Fundstelle(Grenzpunkt)
wieder
aufzustellen. Der Stein ist unbeschriftet, auf dem Kopf erkennt man
einen eingemeißelten Stern. Nach weitern 500 m erreichen wir
die südöstliche Ecke des
Schönborner Waldes. Dort
steht schräg gegenüber einem stillgelegten Waldbrunnens
der Stein Nr. 1 der Grenzlinie. Er ist aus Rotliegendem, ist
unregelmäßig geformt undmit "SB" und "I"
beschriftet.
Auf den schrägen Kopf ist ein Kreuz eingemeißelt.
Hier
stießen die Gebiete der Schönborner, der Ysenburger
und die
Biegermark, später Hintermark, aneinander.Auf der anderen Seite des Weges lag der Kopf eines anderen, nur roh behauenen historischen Grenzsteines mit jeweils einem eingemeißelten Kreuz auf drei Seiten. Er wurde gesichert und hat seine Heimat im Langener Lapidarium gefunden.
Anmerkung 4/2018: Am 7. April wurde der Stein in einer gemeinsamen Aktion des Heimat- und Geschichtvereins Heusenstamm und den Freunden Sprendlingens 200 m weiter südlich an der Kreuzung der Alten Babenhäuser Straße (Oberste Straße) mit der Dietzenbacher Verbindungslandwehr wieder aufgestellt. Daneben wurde eine Holzstele mit einem QR-Code eingesetzt. Darüber wurde in der OP-online berichtet.
 Wir gehen
zurück zum Stein Nr. 1 und beginnen die
Südseite
des Schönborner Waldes zu erkunden. Die Steine dort sind sehr
archaisch; sie sind unregelmäßig und besitzen
unterschiedliche Größen und Formen. Sie bestehen
alle aus
sehr grobem Rotliegenden. Bei vielen ist auf einer Seite, bei manchen
auf
beiden Seiten ein Kreuz eingemeißelt. Die meisten haben ein
kleineres Kreuz
als Weisung und sind auf einer Seite mit "SB" beschriftet. Die
Ausrichtung auf der Südgrenze ist nicht einheitlich, auch
stehen
manche Steine nicht auf Grenzpunkten. Dies deutet darauf hin, dass
einige nicht auf ihrem ursprünglichen Standort stehen. Einige
tragen keine Nummer, was bedeuten kann, dass sie später als
Ersatzsteine gesetzt worden sind. Interessant ist ebenso, dass (weiter
westlich) ca. 8 m südlich des Weges entfernt der
Grenzgraben (?) verläuft, die Steine aber relativ dicht
am Weg stehen. Von den einst 16 Steinen der Südgrenze ist
leider nur noch die Hälfte vorhanden.
Wir gehen
zurück zum Stein Nr. 1 und beginnen die
Südseite
des Schönborner Waldes zu erkunden. Die Steine dort sind sehr
archaisch; sie sind unregelmäßig und besitzen
unterschiedliche Größen und Formen. Sie bestehen
alle aus
sehr grobem Rotliegenden. Bei vielen ist auf einer Seite, bei manchen
auf
beiden Seiten ein Kreuz eingemeißelt. Die meisten haben ein
kleineres Kreuz
als Weisung und sind auf einer Seite mit "SB" beschriftet. Die
Ausrichtung auf der Südgrenze ist nicht einheitlich, auch
stehen
manche Steine nicht auf Grenzpunkten. Dies deutet darauf hin, dass
einige nicht auf ihrem ursprünglichen Standort stehen. Einige
tragen keine Nummer, was bedeuten kann, dass sie später als
Ersatzsteine gesetzt worden sind. Interessant ist ebenso, dass (weiter
westlich) ca. 8 m südlich des Weges entfernt der
Grenzgraben (?) verläuft, die Steine aber relativ dicht
am Weg stehen. Von den einst 16 Steinen der Südgrenze ist
leider nur noch die Hälfte vorhanden.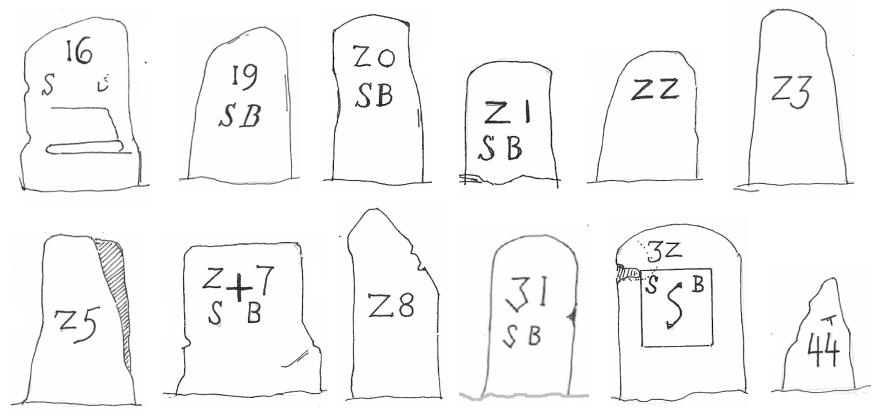 Die nebenstehenden
Zeichnungen von Luise Hubel zeigen sehr eindrucksvoll die
unterschiedlichen "archaischen" Formen einiger Steine, die die
Westgrenze des Schönborner Waldes markieren. Man kann
darüber spekulieren, ob die Steine identisch sind mit denen,
die in der oben gezeigten Karte
von
1585 eingezeichnet sind. Als die
Schönborner 1661 das Gebiet übernahmen,
könnten sie "SB" zusätzlich in die Steine
hineinmeißeln lassen haben. Das würde die
unterschiedliche
Anordnung der Zahlen und Buchstaben erklären. Gegen diese
These spricht, dass auf der Karte die Steine anders nummeriert sind als
die Steine im Wald. Unser Stein Nr. 16, der auf der Karte mit
"Hogestein" gekennzeichnet ist, hat die Nummer 8. Um diesen Widerspruch
zu klären, ist wohl noch einige Archivarbeit
notwendig.
Die nebenstehenden
Zeichnungen von Luise Hubel zeigen sehr eindrucksvoll die
unterschiedlichen "archaischen" Formen einiger Steine, die die
Westgrenze des Schönborner Waldes markieren. Man kann
darüber spekulieren, ob die Steine identisch sind mit denen,
die in der oben gezeigten Karte
von
1585 eingezeichnet sind. Als die
Schönborner 1661 das Gebiet übernahmen,
könnten sie "SB" zusätzlich in die Steine
hineinmeißeln lassen haben. Das würde die
unterschiedliche
Anordnung der Zahlen und Buchstaben erklären. Gegen diese
These spricht, dass auf der Karte die Steine anders nummeriert sind als
die Steine im Wald. Unser Stein Nr. 16, der auf der Karte mit
"Hogestein" gekennzeichnet ist, hat die Nummer 8. Um diesen Widerspruch
zu klären, ist wohl noch einige Archivarbeit
notwendig. 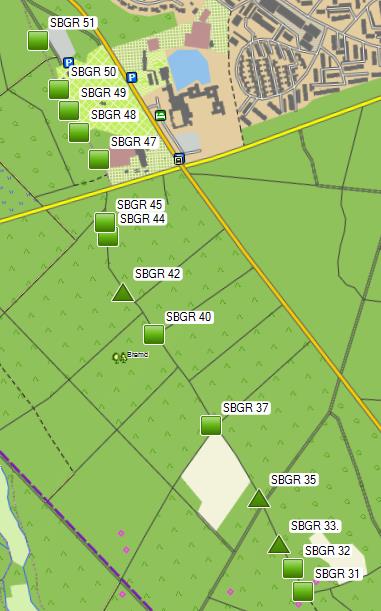
Anmerkung April 2016: Beim Aufstellen des o.g. Grenzpfahls am ehemaligen Standort des Dreiherrensteins fällt ein Graben auf, der sich von dieser Stelle nach Nordosten zieht. Nach ca. 60 m macht er einen Knick. Man findet dort den Stein Y-CF 72. Er trägt die Nummer 72 auf dem Kopf und ist auf einer Seite mit einem "G" gekennzeichnet. Es handelt sich um einen Stein der Grenze des Ysenburger Forst Offenbach und dem Territorium des Deutschen Ordens, dem Deutschherrenwald bzw der spätere Wildhofwald. Man kann dem Graben bis zur Autobahn folgen. Dort stehen noch acht weitere, teils mit Ziffern gekennzeichnete Steine (72 - 81). Frau Luise Hubel hat die Grenzsteine im April 2001 dokumentiert. Die Karte mit dem Grenzverlauf und die Zeichnungen der Grenzstein bis zur Autobahn können hier angeklickt werden. Frau Hubel ist der Auffassung, dass die Steine wahrscheinlich um 1547 gesetzt worden sind. Das "G" bedeutet "Gemarkungsgrenze" und sei nach einer Instruktion für Feldgeschworene nach 1833 nachträglich eingemeißelt worden. Die Grenze verläuft weiter über die Autobahn Richtung Nordosten, wo weitere Grenzsteine stehen, die aber hier nicht beschrieben werden sollen.
Nach oben